Es ist nicht ganz einfach. Ich wundere mich darüber. Ich dachte, diesen Raum für mich zu schaffen, würde mir grosse Freiheit erlauben. Redefreiheit, Schreiben ohne Grenzen, endlose Inspiration, sinnloses Drauflosschreiben, nicht ins die Stille eines Tagebuchs oder in nie wieder gelesenen Dokumente auf der Festplatte vergraben, sondern irgendwo untergebracht, wo man mich findet. Ich mag den Gedanken, dass andere lesen, was in mir vorgeht. Menschen- Rudeltiere, wir existieren nur mit den anderen. Ohne ein Echo könnte ich wohl nicht leben, nur mit mir alleine, ohne andere, die mich verstehen, die meine Stimme vernehmen. Einen Tag ohne Menschen, das passiert manchmal. Menschen, die mir auf der Strasse begegnen, Stimmen, die ich im Supermarkt höre, Gesten, die ich beobachte, aber nicht immer nehme ich daran teil. Manchmal sind da Tage, an denen bin ich einfach nur mit mir. Und selten sind das richtig gute Tage. Ohne menschlichen Kontakt verschließe ich mich immer mehr. Ich fühle mich mehr und mehr nicht dazugehörig, als hätte ich keine Genehmigung, am Leben um mich herum teilzunehmen. Da muss ich an eine Szene denken, die mir einmal in einem Supermarkt passiert ist: Ich stand dösend an der Kasse, als mich eine Frau von hinten ansprach: „Sind sie gerade ansprechbar?“ Und dann stellte sie mir irgendeine recht banale Frage. Ich fand das erstaunlich. Das war so echt. Das traf so genau das, was ich und sicher viele andere oft fühlen: nicht ansprechbar zu sein, weil man so in sich eingeschlossen ist, weil man sich so unbeteiligt fühlt an dem, was um einen herum passiert. Diese Frau, um sie mal anschaulich zu machen war, die Gesellschaft würde es wohl „minderbemittelt“ nennen. Nachdem sie ihre Frage gestellt hatte, ließ sie kaum noch von mir ab. Fing an mir vom Meer zu erzählen. Es war ziemlich wirr und so war die Frau sicher auch innerlich. Wirre Menschen aber, ich möchte mir gerne etwas von ihnen abgucken.
Und da denke ich an gestern Abend. Ich war auf einem Konzert des „Menschensinfonieorchesters“. Klingt ganz groß. Ist es auch, aber im Kleinen. Es sind an die zwölf Musiker, Menschen aus allen Kulturen. Die meisten haben einen anderen Lebensentwurf als den, die Gesellschaft im Allgemeinen propagiert. Keine Karriere, wohl eher so, dass es zum Leben reicht, manchmal auch nicht. So wie jeder Mensch (s)ein oder mehrere Talente hat, haben diese Menschen ihr Talent und ihre Freude in der Musik gefunden. Es war ein Konzert, wo zum Mitspielen eingeladen wurde. Jeder konnte sein Instrument mitbringen und wurde ganz zwanglos in dem Orchester integriert. Mich hat es auch erwischt, ich kann kein Instrument, singe aber gerne. Das sagte ich (dummerweise...) zu Anfang und wurde gleich als Sängerin vor ein Mikro gestellt. Ohne das Lied zu kennen, durfte ich einfach frei nach Lust und Laune irgendwelche Töne zu einem schönen Blues-Rhythmus machen. Ich war aufgeregt, aber dennoch erstaunlich mutig. Manchmal rutschten mir recht laute Töne aus der Kehle. Ich fühlte mich fast wohl dort inmitten der Musiker. Im Publikum waren nicht sehr viele Menschen, vielleicht fünfzehn. Aber auch die machten es leicht, sich zu öffnen. Das war gleich beim Betreten des Raumes schon spürbar geworden. Es fand in einer Kirche statt, das Publikum waren zum größten Teil Menschen, die in der Kirche ihren sozialen Halt finden. Sie können in dort Essen für wenig Geld, finden Ansprache und Hilfe für den Alltag. „Die anderen“ Menschen, Kleidung, die getragen wird, damit man halt was an hat, Haare, die irgendwie da sind, eine Körperhaltung, die Müdigkeit und ein Hängenlassen verrät. Das Bier in der Hand. Ich auch. Menschen, die ich eher meiden würde, ich habe nichts gegen sie, aber muss ihnen auch nicht zu nah kommen. Aber hier in diesem Konzert waren wir nah. Und ich lernte dabei. Ich lernte, dass diese Menschen, zumindest an diesem Abend, absolut „ansprechbar“ waren. Sie redeten, manchmal vielleicht ein wenig zu laut. Sie klatschten nicht nur passiv und höflich Beifall, sondern riefen ihre Begeisterung aus. Es flog mal ein Kronkorken auf die Bühne. Erst erschreckte ich ein wenig, rollte vielleicht leicht die Augenbrauen hoch, dann glaubte ich aber zu verstehen, dass es nicht „zerstörerisch“ gemeint war, sondern Ausdruck von Freude. Einige tanzten auch, sehr temperamentvoll teilweise, so dass auch dass in mir manchmal ein gewisses Unwohlsein erzeugte. Ich verstand aber, dass ich umzudenken habe. Die Menschen wollten nichts Böses, sie lebten einfach etwas aus, auf ihre Art. Vielleicht ähnlich wie Kinder, denen man einige gesellschaftlichen Regeln nicht beigebracht hat.
Mir tat es sehr gut dort zu sein. Ich war ansprechbar, nicht nur das, ich habe angesprochen, sogar gesungen. Ich bin Menschen nah gekommen, denen ich selten nahe komme.
Vielleicht kann ich etwas mitnehmen, von dieser Erfahrung, in meinen verschlossenen, trüben Tagen. Dann erinnere ich mich daran, das ich mich nur einmal öffnen muss, nur einem Menschen zuerst, das reicht dann oft schon, um mich in den „Modus“ zu versetzen, der mich ins Leben zurückholt.
Freitag, 11. April 2008
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
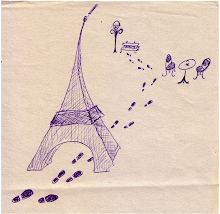
1 Kommentar:
ich finde nichtansprechbarkeit kann sich fortpflanzen, genauso wie geselligkeit. wieviel einfacher ist es jemanden kennen zu lernen, wenn du mit freunden unterwegs bist. selbst wenn du kein großer socializer bist: die anderen stecken dich an. vor allem beflügelt, wenn du auftriffst auf andere, dein lachen, deine ideen teil einer gruppe werden, einer welle, die sich fortpflanzt. dann entstehen schnell neue produktionen, eine welle wird zur brandung.
mich interessiert die frage, warum wir manchmal absinken bis zur sprachlosigkeit, und auch andere kaum an- oder aufnehmen, um uns mitzuteilen. unsere dünnhäutige existenz unter der käseglocke, wenn menschen nur schatten sind, denen wir scheinbar keine realität verleihen können.
abdriften in ein persönliches schwarzes loch, in ein nirwana des ich? fühlen sich so autisten, die selbst einfache emotionale signale wie das heben der hände oder das trocknen von tränen nicht ohne wörterbuch dechiffrieren können?
ich glaube ja, dass es so manches mit unserem modernen leben, und vielleicht sogar mit deutschland zu tun hat. der hohe turm der innerlichkeit. unser verzärteltes selbst. diese anderen, die nicht mehr drinnen sein können, in dieser kleinen geschichte, leiden an der umgekehrten krankheit. so er-innern wir uns gegenseitig. genauso wie zum beispiel das schwarze kind, das seine hand in die große der dicken, weißen erwachsenen legt - die mutter? ihre vertrautheit macht laune. auch ein spielplatz motorisiert die seele, da muss nicht mal sonne sein.
aber die schlacht ist noch nicht gewonnen.
Kommentar veröffentlichen