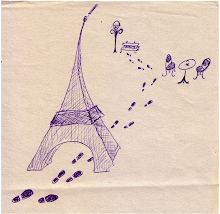Nun ist unser gutes 2009 plötzlich das alte Jahr geworden. Nicht mal ein Jahr alt geworden, und schon ist es alt. Und das Neue wartet gleich darauf das „Alte“ zu ersetzen.
Was heißt das denn für uns? Heute heißt das eine lange Party, Sekt trinken und bunte Lichter im Himmel angucken. Es heißt um Mitternacht Menschen zu umarmen und ein Gefühl zu teilen, dass etwas von Neulust und Aufbruch hat. Da sind neue Hoffnungen. Die Schulstunde ist zu Ende, der Gong tönt. Etwas ist geschafft, Ortswechsel, Zeitwechsel. Wir schreiben eine neue Zahl. 2010 schreibt sich gut, hab schon ein paar Schönschriftversuche gemacht.
Und dann, nach der langen Nacht, kommt ein später Morgen. Er ist immer grau, und fühlt sich immer gleich an: Neujahr. Der 1. Januar. Das kann kein guter Tag sein. Alles, was am Vortag noch wie ein Geschenk von etwas Neuem war, wo sich Vorsätze gut anfühlten und Hoffnungen real schienen, kommt nun die graue Realität. Nun gilts! Und wo soll man an einem grauen, verkaterten Feiertag, von dem, aus man in einen grauen, kalten Januar, plus Februar, blickt, bloß die Kraft und den Mut hernehmen die Vorsätze und die Neulust zu bewahren??! Die Uhr wird neu aufgezogen. Wieder beginnt sie von vorne ihr TickTack, und am ersten Januar gibt es so Momente, wo man gerne mal ein paar TickTack-freie Momente hätte.
So geht es zumindest mir.
Ein schönes Ritual, das ich mir angewöhnt habe, ist, am ersten Januar meinen Jahresrückblick zu schreiben. Kann ich nur empfehlen. Ich gehe die einzelnen Phasen des letzten Jahres durch. Hinterher wird ein dickes Paket daraus. Das alte Jahr, nun festverschnürt, habe ich es noch mal gepackt, und nun bleibt es da und ich bin bereit für das Neue.
Den zwei oder drei Lesern meines Blogs wünsche ich einen guten Übergang! Eure Neulust soll sich nicht durch den Kater und das Loch des ersten Januars trüben lassen. Und dann auf in eine neue Maßeinheit, an deren Ende wir wieder mit einem Glas Sekt stehen und mal schauen, was wir draus gemacht haben. Macht was Schönes draus!
Donnerstag, 31. Dezember 2009
Sonntag, 27. Dezember 2009
Das war Weihnachten
Das war`s. Weihnachten liegt hinter uns. Und ich liege im Bett und bin schwermütig. Ich sollte etwas schreiben, das hilft meistens. Nach so vielen Tagen, an denen man nichts tat, was den Geist so erfreute, wie Schreiben das vermag, fühle ich mich ein wenig hohl.
Ich könnte an den heiligen Abend zurückwandern, der ist ja auch noch nicht verarbeitet. Der Tag fing schön, sehr schön an, mit einem Text, der mir zu schreiben guttat, und einem Gefühl, was zwar weihnachtlich passend mit Liebe zu tun hatte, aber auch an jedem anderen Tag hätte geschrieben werden können.
Ich ging auf die Strasse, radelte durch die halbe Stadt, und es entstand nicht das mir so bekannte Gefühl von „Heute ist was Besonderes- Du weißt es doch auch?!“ Ich spürte nicht in jeder Zelle „Heilig Abend“ und die anderen Menschen sahen auch nicht nach „Heilig Abend“ aus. Nicht jeder Schritt, den man tat, war ein Heilig Abend-Schritt, nicht jedes Brot, dass man kaufte ein Heilig-Abend-Brot. Und es war gut so. Ich vermisste die „Heute ist was besonderes und alle spüren es!“ - Stimmung nicht.
Sie stellte sich auch nach fünf Stunden festliche Weine verkaufen und „Frohe Weihnachten“ wünschen nicht ein.
Am Nachmittag, auf dem Heimweg, waren alle Schritte getan, alle Brote gekauft, es waren kaum noch Menschen unterwegs. Nach Tagen der Rennerei, der vollen Strassen, vollen Geschäfte, vollen Tüten, war es plötzlich still geworden. Irgendwo läuteten Kirchenglocken.
Ein Jogger lief mir entgegen. Eine Gruppe türkischer Jugendlicher isst Döner. Heilig Abend?
Ich ging zu einem kleinen Bahnhof und wartete auf meinen Zug. In jedem Vierersitz sassen Menschen. Mir schräg gegenüber saß ein Paar. Asiaten, vielleicht Japaner, vielleicht 30 Jahre alt. Er hatte eine Mc Donald s Tüte auf dem Schoß, und verschlang irgendwas von deren Inhalt. Sie schaute ihn dabei mit einem immer wieder angewiderten Blick an. Ich weiß nicht, ob das mit dem Inhalt der Mc Donalds-Tüte oder dem Gespräch zusammenhing. Wo fahren die beiden hin? Am Heilig Abend.
Ich fuhr geradewegs in die Kirche. Dort traf ich meine Mutter und Bruder. Und viele Menschen, die kirchenfreundlich still waren, in dicken Winterjacken, mit frisch geföhnten Haaren. Warten, bis der Gottesdienst anfängt. Alles schläft, einer wacht. Alles still, einer spricht. Das war ich. Hatte meine Mutter doch paar Tage nicht gesprochen.
Dann spricht der Pastor. Den mag ich. Ein ganz alter Mann, mit ganz weißen Haaren und ganz blauen Augen. Ein sehr liebevoller, sanfter Mensch. Er freut sich am Fest, und an uns, seinen Gästen sagt nicht: „Heute an Weihnachten sind dann doch mal wieder die Kirche voll.“ Er sagt: „Alle sind so brav, vor allem die Kleinen. Hier in der ersten Reihe sitzt so einer. Ich suchte immer seinen Blick, wollte ihm zuwinken. Aber er ist so brav und still, er sieht mich gar nicht.“
Er erinnert uns an die, die gerade nicht hier sein können. Weil sie krank sind. Oder auch weil sie die Kirche vergessen haben.
Ich bekomme feuchte Augen. Weihnachten. Macht einen so sentimental.
Stille Nacht begleitet den Weißhaarigen mit seinem Gefolge hinaus. Gottesdienst vorbei. Ich drehe mich zu meiner Mutter. „Frohe Weihnachten“, sagt sie und gibt mir die Hand. Ich muss sie feste umarmen. „Frohe Weihnachten und viel Kraft!“ wünsche ich ihr, denn die kann sie gerade gut gebrauchen. Wenn man Tränen in den Augen hat, muss man so was sagen.
Beim Hinausgehen kommen wir an meinen lieben Pastor vorbei. Er sitzt dort auf seinem Rollator und schüttelt jedem die Hand. Ich habe Glück, bekomme seine beiden Hände. „Uh, so kalte Hände. Warum das denn?“ fragt er mich und wir lächeln uns mit den Augen an.
Draußen umarme ich meinen Bruder. Fester als sonst.
Ich hole mein Handy aus der Tasche. Es kündigt mir eine Nachricht an. „Weihnachten ist Liebe“ steht darin. Geschrieben von dem, an den ich zwischen Stiller Nacht und Halleluja, zwischen Föhnfrisuren und dem Friedenszeichen, zwischen Tränen und einem offenen Herzen, am meisten gedacht habe.
Ich könnte an den heiligen Abend zurückwandern, der ist ja auch noch nicht verarbeitet. Der Tag fing schön, sehr schön an, mit einem Text, der mir zu schreiben guttat, und einem Gefühl, was zwar weihnachtlich passend mit Liebe zu tun hatte, aber auch an jedem anderen Tag hätte geschrieben werden können.
Ich ging auf die Strasse, radelte durch die halbe Stadt, und es entstand nicht das mir so bekannte Gefühl von „Heute ist was Besonderes- Du weißt es doch auch?!“ Ich spürte nicht in jeder Zelle „Heilig Abend“ und die anderen Menschen sahen auch nicht nach „Heilig Abend“ aus. Nicht jeder Schritt, den man tat, war ein Heilig Abend-Schritt, nicht jedes Brot, dass man kaufte ein Heilig-Abend-Brot. Und es war gut so. Ich vermisste die „Heute ist was besonderes und alle spüren es!“ - Stimmung nicht.
Sie stellte sich auch nach fünf Stunden festliche Weine verkaufen und „Frohe Weihnachten“ wünschen nicht ein.
Am Nachmittag, auf dem Heimweg, waren alle Schritte getan, alle Brote gekauft, es waren kaum noch Menschen unterwegs. Nach Tagen der Rennerei, der vollen Strassen, vollen Geschäfte, vollen Tüten, war es plötzlich still geworden. Irgendwo läuteten Kirchenglocken.
Ein Jogger lief mir entgegen. Eine Gruppe türkischer Jugendlicher isst Döner. Heilig Abend?
Ich ging zu einem kleinen Bahnhof und wartete auf meinen Zug. In jedem Vierersitz sassen Menschen. Mir schräg gegenüber saß ein Paar. Asiaten, vielleicht Japaner, vielleicht 30 Jahre alt. Er hatte eine Mc Donald s Tüte auf dem Schoß, und verschlang irgendwas von deren Inhalt. Sie schaute ihn dabei mit einem immer wieder angewiderten Blick an. Ich weiß nicht, ob das mit dem Inhalt der Mc Donalds-Tüte oder dem Gespräch zusammenhing. Wo fahren die beiden hin? Am Heilig Abend.
Ich fuhr geradewegs in die Kirche. Dort traf ich meine Mutter und Bruder. Und viele Menschen, die kirchenfreundlich still waren, in dicken Winterjacken, mit frisch geföhnten Haaren. Warten, bis der Gottesdienst anfängt. Alles schläft, einer wacht. Alles still, einer spricht. Das war ich. Hatte meine Mutter doch paar Tage nicht gesprochen.
Dann spricht der Pastor. Den mag ich. Ein ganz alter Mann, mit ganz weißen Haaren und ganz blauen Augen. Ein sehr liebevoller, sanfter Mensch. Er freut sich am Fest, und an uns, seinen Gästen sagt nicht: „Heute an Weihnachten sind dann doch mal wieder die Kirche voll.“ Er sagt: „Alle sind so brav, vor allem die Kleinen. Hier in der ersten Reihe sitzt so einer. Ich suchte immer seinen Blick, wollte ihm zuwinken. Aber er ist so brav und still, er sieht mich gar nicht.“
Er erinnert uns an die, die gerade nicht hier sein können. Weil sie krank sind. Oder auch weil sie die Kirche vergessen haben.
Ich bekomme feuchte Augen. Weihnachten. Macht einen so sentimental.
Stille Nacht begleitet den Weißhaarigen mit seinem Gefolge hinaus. Gottesdienst vorbei. Ich drehe mich zu meiner Mutter. „Frohe Weihnachten“, sagt sie und gibt mir die Hand. Ich muss sie feste umarmen. „Frohe Weihnachten und viel Kraft!“ wünsche ich ihr, denn die kann sie gerade gut gebrauchen. Wenn man Tränen in den Augen hat, muss man so was sagen.
Beim Hinausgehen kommen wir an meinen lieben Pastor vorbei. Er sitzt dort auf seinem Rollator und schüttelt jedem die Hand. Ich habe Glück, bekomme seine beiden Hände. „Uh, so kalte Hände. Warum das denn?“ fragt er mich und wir lächeln uns mit den Augen an.
Draußen umarme ich meinen Bruder. Fester als sonst.
Ich hole mein Handy aus der Tasche. Es kündigt mir eine Nachricht an. „Weihnachten ist Liebe“ steht darin. Geschrieben von dem, an den ich zwischen Stiller Nacht und Halleluja, zwischen Föhnfrisuren und dem Friedenszeichen, zwischen Tränen und einem offenen Herzen, am meisten gedacht habe.
Freitag, 11. Dezember 2009
Nachts
Nur kurz heute. man muss sich ja auch mal kurz fassen. Kleine Gedanken einstreuen, das sollte ich mir eh mal angewöhnen hier.
Ich konnte heute nacht nicht schlafen. Also trieb ich mich im Internet rum. Ich war auf einer Community-Seite und plötzlich fiel mir auf, dass ich dort nicht alleine war. Es war vier Uhr Nachts und 6735 Leute sind online. Nur auf einer Seite. Kann das sein? Hat sich da jemand verzählt? Vielleicht bin ich naiv zu denken, dass die Menschen gegen zwölf ins Bett gehen, dort mit dem Kopf auf dem Kissen bleiben bis vielleicht sieben Uhr morgens, und das einzige, was sie in der Zwischenzeit erlebt haben, ihre Träume sind. Ich frage mich, was das für Menschen sind, die die Nacht wie den Tag verleben. Schlaflose? Arbeitslose? Leidenschaftliche?
Ich glaube, das nimmt mich deshalb so mit weil ich das Gefühl habe, die Welt hat ein Geheimnis vor mir.
Kann irgendjemand das verstehen?
Ich konnte heute nacht nicht schlafen. Also trieb ich mich im Internet rum. Ich war auf einer Community-Seite und plötzlich fiel mir auf, dass ich dort nicht alleine war. Es war vier Uhr Nachts und 6735 Leute sind online. Nur auf einer Seite. Kann das sein? Hat sich da jemand verzählt? Vielleicht bin ich naiv zu denken, dass die Menschen gegen zwölf ins Bett gehen, dort mit dem Kopf auf dem Kissen bleiben bis vielleicht sieben Uhr morgens, und das einzige, was sie in der Zwischenzeit erlebt haben, ihre Träume sind. Ich frage mich, was das für Menschen sind, die die Nacht wie den Tag verleben. Schlaflose? Arbeitslose? Leidenschaftliche?
Ich glaube, das nimmt mich deshalb so mit weil ich das Gefühl habe, die Welt hat ein Geheimnis vor mir.
Kann irgendjemand das verstehen?
Sonntag, 15. November 2009
Dankbar
Ich habe lange nichts mehr geschrieben. Und habe sogar schon Beschwerden darüber erhalten. Naja eine Beschwerde. Aber ich selber beschwere mich auch. Bei mir. Schreiben ist auch immer eine Herausforderung. Es soll ja was herauskommen, was mir gefällt. Und die Gefahr, dass mir das nicht gelingt, ist immer da.
Sei s drum (dieser Ausdruck gefällt mir hier und jetzt), jetzt schreibe ich.
Wieder einmal habe ich kein Thema parat. Wieder einmal ist eigentlich nicht richtig. Denn wenn ich hier was für den Blog schreibe, dann doch meistens aus einem Motiv heraus. Der Fotograph hat das Motiv bereits vor Augen, jetzt gilt es, dieses zu fixieren.
Als ich mich eben auf dem Weg in dieses Café befand, dachte ich darüber nach, welches mein Motiv sein könnte. Mir ist eingefallen, dass ich mich gerade sehr dankbar fühle. Die Dinge, für die ich dankbar bin, könnte ich doch eigentlich gut mal „in die Welt“ schreiben.
Gestern war mir etwas mulmig. Ich hatte den ersten Tag in einem vielleicht neuen, kleinen Job. In einem neuen, kleinen Café wollte ich gerne mitarbeiten. Am ersten Tag fühlt man sich erstmal wenig wohl. „Die Neue“ ist eine schlechte Rolle. Aber es ging alles sehr gut. Ich legte den Unsicherheitsmantel schnell ab, und machte einfach. Ich versuchte das Zögern aus den Bewegungen zu nehmen. „Das ist dein erster Tag heute? Du bist wie gemacht für diesen Ort!“ sagten mir Gäste. Wer zögert da noch lange. Ich zögerte, meine neue Chefin zu umarmen. Und dann tat sie es. Dafür bin ich dankbar.
Heute war ich inmitten meiner Familie. Das ist kein grosses Ding. Da sind meine Eltern und meine Grosseltern. Mein Bruder gehört auch noch zu dem Paket, aber der war heute nicht dabei. Opa hat Geburtstag. Wir sind bei der Oma im Altenheim und trinken Kaffe und essen Kuchen. Opa ist für seine Jahre noch ganz schlagfertig. „Wie alt bist du nun eigentlich geworden?“ „39“, sagt der 93-Jährige.
Irgendwie ist alles gut. Wenn auch die Oma so still ist. Der Opa auch wieder grosse, zum x-ten Mal wiederholte Reden schwingt. Der Papa uns mit seinen Fragen traurig oder genervt stimmt, weil er uns wieder bewusst macht, dass er alt geworden ist. Die Mama angespannt den Tisch deckt und die Augen über des Mannes unmündiges Verhalten rollt. So ist doch alles gut. Ich habe sie alle lieb, und sie haben mich alle lieb (bei dem Opa bin ich mir nicht so sicher, aber ich habe Zeit genug gehabt mich damit abzufinden). Sie haben mich sogar so lieb, dass sie nicht wollen, dass ich nachher am kalten, dunklen Bahnsteig auf einen Zug warten muss, und nehmen einen grossen Umweg in Kauf und fahren mich nach Hause.
Ich bin dankbar für meine Familie.
Heute morgen war ich beim Yoga. Der Körper macht brav mit. Er dehnt sich soweit, wie ich es von ihm verlange. Wenn er ziept, dann soll er seine Ruhe haben. Wir sind gute Kumpels. Dafür bin ich dankbar.
Nachher schmolz ich in die Sauna-Holzbänke und dann in die weichen Polster des Liegestuhls. Wir können uns so wohl fühlen, Ich spüre die Wärme und Weichheit immer noch. Dafür bin ich dankbar.
Gerade ist es so mild draussen. Je weniger kalte Tage der Winter hat, umso besser. Dafür bin ich dankbar.
Ich trinke gerade ein kleines Glas Weißwein. So ein kleines Glas Wein fühlt sich in Körper und Geist sehr angenehm an. Ein ähnliches Verschmelzen wie in der warmen Sauna entsteht. Meine Beine verschmelzen in meinen Knien, meine Augen in ihren Kuhlen, mein Atem in meinem warmen Körper. Der Geist verschmilzt mit seiner Umgebung. Die Musik und die Stimmen um mich herum, in diesem sonntagvorabendlichruhigem Café verwabern sich, mein Blick fixiert sich, da wo er sich sonst nicht zu ruhen erlaubt, manche Fragen stellt man sich einfach nicht mehr. Dafür bin ich dankbar.
Ich bin dankbar, dass ich auf diesem feinen Computer tippen darf, der mir von einem sehr feinen Menschen geschenkt wurde.
Ich bin dankbar, dass ich diese Hose tragen kann, weil ich sie auf einem Flohmarkt für wenige Euro fand. Ebenso die Schuhe. Und die Bluse. Ich bin dankbar für meinen Spürsinn. Oder für den Typ da oben, der die Fäden zieht, und mich so oft im richtigen Moment an die richtige Stelle lenkt. Ich bin dankbar, dass ich diese Intuition fühlen kann.
Ich bin dankbar, dass der Yoga-Lehrer uns heute morgen so eine lange End-Entspannung gegönnt hat, und mit langem Atem den ganzen Körper mit uns durchgegangen ist.
Ich bin dankbar, dass ich ihm dafür gedankt habe. Und dass er sich bei mir dafür bedankt hat.
Ich bin dankbar dafür, dass ich am heutigen Sonntagabend nicht mit Grummeln an die bevorstehende Woche denken muss.
Ich bin dankbar, dass ich in einer Stunde die Treppe in meinem Haus hinuntersteige, und mit meinen befreundeten Nachbarn/benachbarten Freunden, gemeinsam „Tatort“ schauen werde. Wir könnten auch „Musikantenstadl“ anschauen, mir egal, ich freue mich einfach mit diesen Menschen so etwas wie Familie zu fühlen.
Wird es langsam kitschig? Zuviel des Dankens? Es gibt da ein Kirchenlied. Es kann eigentlich nur evangelisch sein. Es geht so: „Danke für diesen guten Morgen, Danke für jeden neuen Tag, Danke (für dies und jenes, habe ich vergessen)... Danke, dass ich danken kann.“ Kennt das jemand? Musste ich gerade dran denken.
Na gut, ich höre auf. Wird jetzt eh Zeit. Gleich kommt Tatort.
Sei s drum (dieser Ausdruck gefällt mir hier und jetzt), jetzt schreibe ich.
Wieder einmal habe ich kein Thema parat. Wieder einmal ist eigentlich nicht richtig. Denn wenn ich hier was für den Blog schreibe, dann doch meistens aus einem Motiv heraus. Der Fotograph hat das Motiv bereits vor Augen, jetzt gilt es, dieses zu fixieren.
Als ich mich eben auf dem Weg in dieses Café befand, dachte ich darüber nach, welches mein Motiv sein könnte. Mir ist eingefallen, dass ich mich gerade sehr dankbar fühle. Die Dinge, für die ich dankbar bin, könnte ich doch eigentlich gut mal „in die Welt“ schreiben.
Gestern war mir etwas mulmig. Ich hatte den ersten Tag in einem vielleicht neuen, kleinen Job. In einem neuen, kleinen Café wollte ich gerne mitarbeiten. Am ersten Tag fühlt man sich erstmal wenig wohl. „Die Neue“ ist eine schlechte Rolle. Aber es ging alles sehr gut. Ich legte den Unsicherheitsmantel schnell ab, und machte einfach. Ich versuchte das Zögern aus den Bewegungen zu nehmen. „Das ist dein erster Tag heute? Du bist wie gemacht für diesen Ort!“ sagten mir Gäste. Wer zögert da noch lange. Ich zögerte, meine neue Chefin zu umarmen. Und dann tat sie es. Dafür bin ich dankbar.
Heute war ich inmitten meiner Familie. Das ist kein grosses Ding. Da sind meine Eltern und meine Grosseltern. Mein Bruder gehört auch noch zu dem Paket, aber der war heute nicht dabei. Opa hat Geburtstag. Wir sind bei der Oma im Altenheim und trinken Kaffe und essen Kuchen. Opa ist für seine Jahre noch ganz schlagfertig. „Wie alt bist du nun eigentlich geworden?“ „39“, sagt der 93-Jährige.
Irgendwie ist alles gut. Wenn auch die Oma so still ist. Der Opa auch wieder grosse, zum x-ten Mal wiederholte Reden schwingt. Der Papa uns mit seinen Fragen traurig oder genervt stimmt, weil er uns wieder bewusst macht, dass er alt geworden ist. Die Mama angespannt den Tisch deckt und die Augen über des Mannes unmündiges Verhalten rollt. So ist doch alles gut. Ich habe sie alle lieb, und sie haben mich alle lieb (bei dem Opa bin ich mir nicht so sicher, aber ich habe Zeit genug gehabt mich damit abzufinden). Sie haben mich sogar so lieb, dass sie nicht wollen, dass ich nachher am kalten, dunklen Bahnsteig auf einen Zug warten muss, und nehmen einen grossen Umweg in Kauf und fahren mich nach Hause.
Ich bin dankbar für meine Familie.
Heute morgen war ich beim Yoga. Der Körper macht brav mit. Er dehnt sich soweit, wie ich es von ihm verlange. Wenn er ziept, dann soll er seine Ruhe haben. Wir sind gute Kumpels. Dafür bin ich dankbar.
Nachher schmolz ich in die Sauna-Holzbänke und dann in die weichen Polster des Liegestuhls. Wir können uns so wohl fühlen, Ich spüre die Wärme und Weichheit immer noch. Dafür bin ich dankbar.
Gerade ist es so mild draussen. Je weniger kalte Tage der Winter hat, umso besser. Dafür bin ich dankbar.
Ich trinke gerade ein kleines Glas Weißwein. So ein kleines Glas Wein fühlt sich in Körper und Geist sehr angenehm an. Ein ähnliches Verschmelzen wie in der warmen Sauna entsteht. Meine Beine verschmelzen in meinen Knien, meine Augen in ihren Kuhlen, mein Atem in meinem warmen Körper. Der Geist verschmilzt mit seiner Umgebung. Die Musik und die Stimmen um mich herum, in diesem sonntagvorabendlichruhigem Café verwabern sich, mein Blick fixiert sich, da wo er sich sonst nicht zu ruhen erlaubt, manche Fragen stellt man sich einfach nicht mehr. Dafür bin ich dankbar.
Ich bin dankbar, dass ich auf diesem feinen Computer tippen darf, der mir von einem sehr feinen Menschen geschenkt wurde.
Ich bin dankbar, dass ich diese Hose tragen kann, weil ich sie auf einem Flohmarkt für wenige Euro fand. Ebenso die Schuhe. Und die Bluse. Ich bin dankbar für meinen Spürsinn. Oder für den Typ da oben, der die Fäden zieht, und mich so oft im richtigen Moment an die richtige Stelle lenkt. Ich bin dankbar, dass ich diese Intuition fühlen kann.
Ich bin dankbar, dass der Yoga-Lehrer uns heute morgen so eine lange End-Entspannung gegönnt hat, und mit langem Atem den ganzen Körper mit uns durchgegangen ist.
Ich bin dankbar, dass ich ihm dafür gedankt habe. Und dass er sich bei mir dafür bedankt hat.
Ich bin dankbar dafür, dass ich am heutigen Sonntagabend nicht mit Grummeln an die bevorstehende Woche denken muss.
Ich bin dankbar, dass ich in einer Stunde die Treppe in meinem Haus hinuntersteige, und mit meinen befreundeten Nachbarn/benachbarten Freunden, gemeinsam „Tatort“ schauen werde. Wir könnten auch „Musikantenstadl“ anschauen, mir egal, ich freue mich einfach mit diesen Menschen so etwas wie Familie zu fühlen.
Wird es langsam kitschig? Zuviel des Dankens? Es gibt da ein Kirchenlied. Es kann eigentlich nur evangelisch sein. Es geht so: „Danke für diesen guten Morgen, Danke für jeden neuen Tag, Danke (für dies und jenes, habe ich vergessen)... Danke, dass ich danken kann.“ Kennt das jemand? Musste ich gerade dran denken.
Na gut, ich höre auf. Wird jetzt eh Zeit. Gleich kommt Tatort.
Dienstag, 6. Oktober 2009
WinterZeit
Ich bin enttäuscht. Zufällig werde ich heute um kurz vor sieben wach. Blöd, denke ich, ich hätte doch schön noch ne Stunde schlafen können. Gut, denke ich, dann höre ich gleich wenigstens noch mal die „Machste mir nen Kaffee fertig“-Stimme. Es wird halb sieben, ich lausche. Nichts passiert. Ich denke mir, das muss an der Jahreszeit liegen. Es ist jetzt plötzlich dunkel morgens um halb sieben, und kalt ist es auch. Vermutlich steht der Kioskbesitzer nicht mehr wartend auf „Machste mir nen Kaffee fertig“ vor seinem Laden. Er hat vermutlich nicht mal mehr seine Tür offenstehen. Das heißt „Machste mir nen Kaffee fertig“ muss jetzt eintreten und dort seine Worte sagen. Die höre ich dann nicht mehr. Schade. Der Winter ändert wirklich alles.
Es geht auf sieben Uhr an, plötzlich höre ich „Nen Kaffee!“ Das ist die Stimme. Gleich darauf höre ich die Autotür, und dann höre ich etwas, was ich nicht hören mag. Er hustet und räuspert sich, zieht hoch und spuckt aus. Igittigittiggitttt! Das mag ich gar nicht. Alles wird anders im bösen Winter: Auf halb sieben ist kein Verlass mehr, es ist selbst um sieben noch dunkel, die Stimme sagt nicht mehr den üblichen Satz, ist wohl auch wintermäßig gelaunt und hat nur noch Energie für „nen Kaffee!“ und dann rotzt er auch noch.
Es wird Zeit, dass ich die Meine mal sinnvoller nutze.
Es geht auf sieben Uhr an, plötzlich höre ich „Nen Kaffee!“ Das ist die Stimme. Gleich darauf höre ich die Autotür, und dann höre ich etwas, was ich nicht hören mag. Er hustet und räuspert sich, zieht hoch und spuckt aus. Igittigittiggitttt! Das mag ich gar nicht. Alles wird anders im bösen Winter: Auf halb sieben ist kein Verlass mehr, es ist selbst um sieben noch dunkel, die Stimme sagt nicht mehr den üblichen Satz, ist wohl auch wintermäßig gelaunt und hat nur noch Energie für „nen Kaffee!“ und dann rotzt er auch noch.
Es wird Zeit, dass ich die Meine mal sinnvoller nutze.
Mittwoch, 30. September 2009
Adieu Weisheit!
Gestern ist was passiert! Gestern hat schon Tage vorher Schatten geworfen, die nur durch konzentriertes Nicht-dran-Denken weggepustet werden konnten. Ich musste zum Zahnarzt. Gestern. 14 Uhr. Zuvor stand ich noch auf dem Markt. Ganz banal, zusammen mit so vielen anderen. Ich bekomme heute einen Zahn gezogen. Ich machte Gymnastik zusammen mit anderen. Wie jeden Dienstag. Am Morgen vor einem normalen Dienstag. Ist kein normaler Dienstag. Heute ist Zahnarzt-Dienstag. Weisheitszahnziehdienstag.
14 Uhr. Ich stehe am Pult, vor der Zahnarzthelferin. „Hallo, ich habe jetzt einen Termin.“ Sie blättert hin und her, schaut und schaut, sagt: „Sie stehen hier heute nicht drin. Sie sind für nächsten Dienstag eingetragen.“ Nein, nein, nein, das geht nicht. Ich habe mich mental darauf vorbereitet, dass es heute sein wird. Ich habe nicht nur mich, sondern sämtliche liebe, sorgenvolle Freunde und Mutter, darauf vorbereitet. Ich war auf dem Markt und dachte an Zahnarzt. Ich war beim Sport und dachte an Zahnarzt. Ich kann jetzt nicht heimgehen, mit diesem Zahn im Mund. Vor allem, nicht mit dem Gefühl, es hinter mich gebracht zu haben. „Dann muss das ein Missverständnis sein. Ich bin ganz sicher, dass ihre Kollegin mir diesen Termin gemacht hat.“ „Gut, dann nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Es kann aber eine Weile dauern.“ Oje, noch länger warten. Alle, die wissen, dass ich um 14 Uhr auf dem Stühlchen sitzen werde, müssten nun eigentlich informiert werden, dass sie nicht umsonst an mich denken sollen. Kaum zu Ende gedacht, sagt jemand: „Frau Schmitz bitte.“ Schmitz bin ich. Kann aber nicht ich gemeint sein. Ich muss doch noch warten. Schmitz heißt ja auch hier in dieser Stadt jeder Zehnte. Es steht aber niemand auf. Na gut, wenn sonst kein Schmitz will, dann geh ich eben. Soll ja auch keiner meinen Zahn gezogen bekommen. Wobei, wenn das jemand anderes für mich erledigen könnte, wäre das eine feine Sache.
Ich sitze auf dem blauen Stuhl und Herr Doktor setzt sich neben mich. Klingt gemütlich. Aber jeder weiß, dass das Bild trügt. Herr Doktor setzt die Spritze in meinen Hals, warnt, dass es jetzt unangenehm ist, und lobt, dass ich nicht mal mit der Wimper gezuckt habe. „Ich bin Zahnarzt-Profi,“ protze ich. Nachdem ich noch ein paar Minuten mit meinem scheinbar gewaltig anschwellenden Rachen alleine bleiben darf, kommt er wieder und legt sich schon ins Zeug. Ins Zeug ist in dem Fall mein Mund. Er macht irgendwas. Ich höre ein leichtes Knirschen und dann seine Stimme: „So, das war s.“ „Machen Sie Witze?“ würde ich gerne sagen, wenn ich etwas artikulieren könnte. Er sagt „Auf Wiedersehen“ und ich will ihn nicht gehen lassen. Er kann doch noch nicht fertig sein?! Das hat jetzt nicht mal fünf Minuten gedauert. Ich habe ungefähr 4 Tage lang Schatten weggepustet für nicht mal fünf Minuten Tortur!? Und es war noch nicht mal Tortur. Er lässt sich von mir nicht mehr in ein Gespräch verwickeln, ist schon aus dem Raum. Die Sprechstundenhilfe kann so schnell nicht weg, muss ja noch aufräumen. Ich sitze immer noch auf dem Stuhl und bin verwirrt. Ich erzähle ihr, dass ich verwirrt bin, dass mir das jetzt alles zu schnell ging. Gott sei Dank entdecke ich meinen Zahn. Er liegt blutig und einsam auf dem Tabletttisch. Den will ich mitnehmen. Dann habe ich wenigstens was Greifbares, wenn schon die Erinnerung aufgrund der geringen Zeit nichts hergeben wird. Ich kann die Sprechstundenhilfe nicht länger aufhalten. Sie hat auch überhaupt keine Lust auf mich. Meine Verwirrung findet sie weder lustig, noch interessant. Also muss ich gehen.
Jetzt eigentlich fängt erst das Unangenehme an. Ich beisse brav die Zähne zusammen, um damit den blutsaugenden Wattebausch festzuhalten. Es ist eklig. Alles schmeckt nach Blut. Ich denke an Tampons. Tampon im Mund, muss sich wohl so anfühlen. Solche Gedanken kann ich nur haben, weil ich gerade Charlotte Roches „Feuchtgebiete“ gelesen habe.
Nach ner halben Stunde soll der Tampon raus. Stundenlang blutet es nach, und ich hoffe, dass das alles normal ist. Wenigstens bleibt das Blut in mir, ich verliere kein Blut, denke ich. Ich trinke es ja gleich wieder. Das ist wohl ziemlich naiv gedacht. Und klingt auch wieder sehr nach Charlotte bzw. Helen.
Irgendwann ist der Zahn nicht mehr im Vordergrund. Der Blutgeschmack nicht mehr so präsent. Ich traue mich mal mit der Zunge an den Krater. Und irgendwann habe ich mich auch an den gewöhnt. Alles gut. Ein Freund sagt mir, nun käme die Zahnfee. Das klingt gut.
Nun brauche ich noch einen Schlusssatz. Will mir keiner einfallen.
Dann lasse ich euch eben genauso perplex stehen, wie der Herr Doktor mich hat stehen lassen.
14 Uhr. Ich stehe am Pult, vor der Zahnarzthelferin. „Hallo, ich habe jetzt einen Termin.“ Sie blättert hin und her, schaut und schaut, sagt: „Sie stehen hier heute nicht drin. Sie sind für nächsten Dienstag eingetragen.“ Nein, nein, nein, das geht nicht. Ich habe mich mental darauf vorbereitet, dass es heute sein wird. Ich habe nicht nur mich, sondern sämtliche liebe, sorgenvolle Freunde und Mutter, darauf vorbereitet. Ich war auf dem Markt und dachte an Zahnarzt. Ich war beim Sport und dachte an Zahnarzt. Ich kann jetzt nicht heimgehen, mit diesem Zahn im Mund. Vor allem, nicht mit dem Gefühl, es hinter mich gebracht zu haben. „Dann muss das ein Missverständnis sein. Ich bin ganz sicher, dass ihre Kollegin mir diesen Termin gemacht hat.“ „Gut, dann nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Es kann aber eine Weile dauern.“ Oje, noch länger warten. Alle, die wissen, dass ich um 14 Uhr auf dem Stühlchen sitzen werde, müssten nun eigentlich informiert werden, dass sie nicht umsonst an mich denken sollen. Kaum zu Ende gedacht, sagt jemand: „Frau Schmitz bitte.“ Schmitz bin ich. Kann aber nicht ich gemeint sein. Ich muss doch noch warten. Schmitz heißt ja auch hier in dieser Stadt jeder Zehnte. Es steht aber niemand auf. Na gut, wenn sonst kein Schmitz will, dann geh ich eben. Soll ja auch keiner meinen Zahn gezogen bekommen. Wobei, wenn das jemand anderes für mich erledigen könnte, wäre das eine feine Sache.
Ich sitze auf dem blauen Stuhl und Herr Doktor setzt sich neben mich. Klingt gemütlich. Aber jeder weiß, dass das Bild trügt. Herr Doktor setzt die Spritze in meinen Hals, warnt, dass es jetzt unangenehm ist, und lobt, dass ich nicht mal mit der Wimper gezuckt habe. „Ich bin Zahnarzt-Profi,“ protze ich. Nachdem ich noch ein paar Minuten mit meinem scheinbar gewaltig anschwellenden Rachen alleine bleiben darf, kommt er wieder und legt sich schon ins Zeug. Ins Zeug ist in dem Fall mein Mund. Er macht irgendwas. Ich höre ein leichtes Knirschen und dann seine Stimme: „So, das war s.“ „Machen Sie Witze?“ würde ich gerne sagen, wenn ich etwas artikulieren könnte. Er sagt „Auf Wiedersehen“ und ich will ihn nicht gehen lassen. Er kann doch noch nicht fertig sein?! Das hat jetzt nicht mal fünf Minuten gedauert. Ich habe ungefähr 4 Tage lang Schatten weggepustet für nicht mal fünf Minuten Tortur!? Und es war noch nicht mal Tortur. Er lässt sich von mir nicht mehr in ein Gespräch verwickeln, ist schon aus dem Raum. Die Sprechstundenhilfe kann so schnell nicht weg, muss ja noch aufräumen. Ich sitze immer noch auf dem Stuhl und bin verwirrt. Ich erzähle ihr, dass ich verwirrt bin, dass mir das jetzt alles zu schnell ging. Gott sei Dank entdecke ich meinen Zahn. Er liegt blutig und einsam auf dem Tabletttisch. Den will ich mitnehmen. Dann habe ich wenigstens was Greifbares, wenn schon die Erinnerung aufgrund der geringen Zeit nichts hergeben wird. Ich kann die Sprechstundenhilfe nicht länger aufhalten. Sie hat auch überhaupt keine Lust auf mich. Meine Verwirrung findet sie weder lustig, noch interessant. Also muss ich gehen.
Jetzt eigentlich fängt erst das Unangenehme an. Ich beisse brav die Zähne zusammen, um damit den blutsaugenden Wattebausch festzuhalten. Es ist eklig. Alles schmeckt nach Blut. Ich denke an Tampons. Tampon im Mund, muss sich wohl so anfühlen. Solche Gedanken kann ich nur haben, weil ich gerade Charlotte Roches „Feuchtgebiete“ gelesen habe.
Nach ner halben Stunde soll der Tampon raus. Stundenlang blutet es nach, und ich hoffe, dass das alles normal ist. Wenigstens bleibt das Blut in mir, ich verliere kein Blut, denke ich. Ich trinke es ja gleich wieder. Das ist wohl ziemlich naiv gedacht. Und klingt auch wieder sehr nach Charlotte bzw. Helen.
Irgendwann ist der Zahn nicht mehr im Vordergrund. Der Blutgeschmack nicht mehr so präsent. Ich traue mich mal mit der Zunge an den Krater. Und irgendwann habe ich mich auch an den gewöhnt. Alles gut. Ein Freund sagt mir, nun käme die Zahnfee. Das klingt gut.
Nun brauche ich noch einen Schlusssatz. Will mir keiner einfallen.
Dann lasse ich euch eben genauso perplex stehen, wie der Herr Doktor mich hat stehen lassen.
Labels:
Charlotte Roche,
Weisheitszahn,
Zahnarzt
Donnerstag, 24. September 2009
Morgens, halb sieben, in Ehrenfeld
„Machst du mir nen Kaffee fertig“!? Bitte díesen Satz in schönstem Kölner Dialekt, von einer tiefen Herrenstimme gesprochen, lesen. Diesen Satz höre ich jeden Morgen, pünktlich um halb sieben. Gefolgt von dem Geräusch einer Autotür, die auf- und dann wieder zugemacht wird. Gefolgt von der Klingel des Kiosks, die beim Ein- und Austreten erklingt. Kurze Zeit später wird ein Motor gestartet und manchmal höre ich noch ein paar Wortfetzen.
Mir fällt das jetzt seit einer Woche auf. Ich weiß nicht, ob es das vorher nicht gab, oder ob ich die Stimme vorher einfach überhört habe. „Machst du mir nen Kaffee fertig!?“ immer derselbe Ton, immer dieselbe Melodie, immer dieselben Worte. Warum sagt er nicht mal: „Tust du mir nen Kaffee?“ (wir sind doch schließlich in Köln!), oder „Ich brauch nen Kaffee“ oder, und das fände ich das Natürlichste : „Wie immer.“ Oder „Du weißt ja Bescheid!“ Jeden Morgen gibt er, als sei es das erste Mal die Erklärung ab, dass er einen Kaffee möchte. Das weiß der Kioskbesitzer doch längst. Vermutlich hat er um halb sieben bereits den fertig gemachten Kaffee in der Hand. Überhaupt „Machst du mir nen Kaffee fertig!?“ Was ist daran fertig zu machen? Fertig ist er längst. Steht in der gläsernen Kanne, in die er vor vielleicht einer Stunde langsam hinein tröpfelte. Fertig ist er, wenn er in einen Becher gefüllt ist. Vielleicht sogar schon so, wie der Kaffeetrinker ihn haben möchte. Mit Milch oder ohne. Mit Zucker oder ohne.
Irgendwann werde ich morgens mal aufstehen, mich weit aus dem Fenster lehnen, um zu sehen, wer der Kaffeebesteller ist. Ich habe schon ein gutes Bild von ihm. Ein Mann um die vierzig, vermutlich ein Handwerker, ein freundliches Gesicht, aber auch unnahbar. Ich möchte auch den „fertigen Kaffee“ sehen. Vielleicht ist es kein gewöhnlicher Kaffee zum Mitnehmen. Vielleicht hat er seine Spezialtasse, einen Thermobecher, oder nur einen Plastikbecher, den er gleich auf der Stelle wegschluckt. Denn lange hält er sich ja nicht auf. Nur solange, bis der Kaffee fertig gemacht ist.
Sein Ritual, und das Ritual des Kioskbesitzers wird zu meinem Ritual.
Und man fragt sich, ob ich zuviel Zeit habe... ☺
Mir fällt das jetzt seit einer Woche auf. Ich weiß nicht, ob es das vorher nicht gab, oder ob ich die Stimme vorher einfach überhört habe. „Machst du mir nen Kaffee fertig!?“ immer derselbe Ton, immer dieselbe Melodie, immer dieselben Worte. Warum sagt er nicht mal: „Tust du mir nen Kaffee?“ (wir sind doch schließlich in Köln!), oder „Ich brauch nen Kaffee“ oder, und das fände ich das Natürlichste : „Wie immer.“ Oder „Du weißt ja Bescheid!“ Jeden Morgen gibt er, als sei es das erste Mal die Erklärung ab, dass er einen Kaffee möchte. Das weiß der Kioskbesitzer doch längst. Vermutlich hat er um halb sieben bereits den fertig gemachten Kaffee in der Hand. Überhaupt „Machst du mir nen Kaffee fertig!?“ Was ist daran fertig zu machen? Fertig ist er längst. Steht in der gläsernen Kanne, in die er vor vielleicht einer Stunde langsam hinein tröpfelte. Fertig ist er, wenn er in einen Becher gefüllt ist. Vielleicht sogar schon so, wie der Kaffeetrinker ihn haben möchte. Mit Milch oder ohne. Mit Zucker oder ohne.
Irgendwann werde ich morgens mal aufstehen, mich weit aus dem Fenster lehnen, um zu sehen, wer der Kaffeebesteller ist. Ich habe schon ein gutes Bild von ihm. Ein Mann um die vierzig, vermutlich ein Handwerker, ein freundliches Gesicht, aber auch unnahbar. Ich möchte auch den „fertigen Kaffee“ sehen. Vielleicht ist es kein gewöhnlicher Kaffee zum Mitnehmen. Vielleicht hat er seine Spezialtasse, einen Thermobecher, oder nur einen Plastikbecher, den er gleich auf der Stelle wegschluckt. Denn lange hält er sich ja nicht auf. Nur solange, bis der Kaffee fertig gemacht ist.
Sein Ritual, und das Ritual des Kioskbesitzers wird zu meinem Ritual.
Und man fragt sich, ob ich zuviel Zeit habe... ☺
Dienstag, 22. September 2009
Paris-Köln
Ich bin wieder daheim, und das fühlt sich so gut an. „Das Schönste am Wegfahren ist das nach Hause kommen.“ Irgendjemand hat wohl mal diesen Satz in die Welt geschmissen, und viele haben ihn aufgefangen. Mag ich eigentlich nicht, diese aufgeschnappten Sätze. Aber gerade wird er für mich wahr. Mein Zuhause ist jetzt noch schöner, als es vorher war. Meine Wohnung ist, obwohl sie dringend mal aufgeräumt werden muss, plötzlich so schön, wie neu, die Cafés rundherum sind reizvoller als zuvor, der Rhein strahlender, der Dom imposanter, und auch meine Freunde betrachte ich mit freudiger Dankbarkeit, dafür dass sie halt meine Freunde sind.
Samstag morgen trieb ich mich noch auf einem Trödelmarkt im zweiten Arrondissement, in schönen Strassen, und vor dem Rathausplatz dieses Viertels herum. Dann entdeckte ich noch einen weiteren, wunderschön vor der Kulisse des Place des Abbesses, ein antikes Karussell, die hübschen Montmartre-Häuser und antikes Zeug lag vor langhaarigen, Gauloise-rauchenden Profi-Trödlern. Ein Anblick, der jeden Tourist an diesem herbstlichen, sonnigen Samstagmorgen erfreute. Mich nicht. Doch, äußerlich schon, aber ich war nicht wirklich da. Ich sprach niemand an, kaufte lediglich zwei Sporthosen (eine davon ist ein „Yoga-Rock“: „Vous pouvez ecarter les jambes et rien ne se voit“- Aha, ich kann also die Beine grätschen, ohne dass man was sieht. Kaufe ich. Ist lustig.) Das war aber auch schon fast die lebhafteste Situation meines Trödelmarktmorgens.
Der Sonntag danach: nach einem schönen Frühstück mit Freunden auf der Terrasse von einem Café, radle ich ins nächste Stadtviertel zum Trödelmarkt. Der Platz ist nett, aber nicht annähernd so schön, wie die Pariser Trödelplätze. Ich bin heiter, offen, freue mich an den Dingen, die da rumliegen, plaudere und lache mit den Leuten dahinter, treffe einen Bekannten. Finde eine Kette für meine Mutter, einen Badezimmerteppich, ein T-Shirt, eine Tischdecke, drei Bücher.
Hier ist alles leichter. Hier bin ich einfach da. Hier habe ich mit jedem Schritt, den ich mache, das Gefühl, ich gehöre hier her. Meine Schritte in meiner Stadt.
„In einer Stadt gehört dir nichts“, sagte einmal ein guter Freund, den ich fragte, warum er lieber seinem kleinen Dorf wohne. Genauso wie ihm geht es mir. Nur andersrum. Köln gehört mir. Ich teile es gerne mit 995 378 anderen Kölnern. Du bist Deutschland. Ich bin Köln.
Samstag morgen trieb ich mich noch auf einem Trödelmarkt im zweiten Arrondissement, in schönen Strassen, und vor dem Rathausplatz dieses Viertels herum. Dann entdeckte ich noch einen weiteren, wunderschön vor der Kulisse des Place des Abbesses, ein antikes Karussell, die hübschen Montmartre-Häuser und antikes Zeug lag vor langhaarigen, Gauloise-rauchenden Profi-Trödlern. Ein Anblick, der jeden Tourist an diesem herbstlichen, sonnigen Samstagmorgen erfreute. Mich nicht. Doch, äußerlich schon, aber ich war nicht wirklich da. Ich sprach niemand an, kaufte lediglich zwei Sporthosen (eine davon ist ein „Yoga-Rock“: „Vous pouvez ecarter les jambes et rien ne se voit“- Aha, ich kann also die Beine grätschen, ohne dass man was sieht. Kaufe ich. Ist lustig.) Das war aber auch schon fast die lebhafteste Situation meines Trödelmarktmorgens.
Der Sonntag danach: nach einem schönen Frühstück mit Freunden auf der Terrasse von einem Café, radle ich ins nächste Stadtviertel zum Trödelmarkt. Der Platz ist nett, aber nicht annähernd so schön, wie die Pariser Trödelplätze. Ich bin heiter, offen, freue mich an den Dingen, die da rumliegen, plaudere und lache mit den Leuten dahinter, treffe einen Bekannten. Finde eine Kette für meine Mutter, einen Badezimmerteppich, ein T-Shirt, eine Tischdecke, drei Bücher.
Hier ist alles leichter. Hier bin ich einfach da. Hier habe ich mit jedem Schritt, den ich mache, das Gefühl, ich gehöre hier her. Meine Schritte in meiner Stadt.
„In einer Stadt gehört dir nichts“, sagte einmal ein guter Freund, den ich fragte, warum er lieber seinem kleinen Dorf wohne. Genauso wie ihm geht es mir. Nur andersrum. Köln gehört mir. Ich teile es gerne mit 995 378 anderen Kölnern. Du bist Deutschland. Ich bin Köln.
Sonntag, 20. September 2009
Mit dem Rücken zu Paris
Ich lüge, wenn ich diesen Blog so nenne. Denn ich sitze im Zug, und fahre rückwärts. Das heißt, Paris liegt mir nicht im Rücken, sondern vor mir. Aber es passt so gut, darum gönne ich mir jetzt mal so etwas wie dichterische Freiheit.
Ich bin froh, dass ich mit jedem Kilometer Paris ferner, und Köln näher komme. Ich weiß nicht, wem ich dafür die Schuld geben soll. Paris oder mir. Ist Paris einfach schrecklich laut, dreckig, hektisch, vollgestopft, stereotyp und ermüdend, oder will ich Paris so sehen? Macht die Stadt mich missmutig, angespannt, gestresst und leicht ängstlich, oder kommt das aus meiner Sicht auf die Stadt. Gibt es da wieder nur einen Schalter, den ich umlegen könnte? Lauter Fragen, auf die ich die Antworten ehrlich gesagt, bereits kenne. Ja, ich bin Schuld, dass ich Paris ins schlechte Licht stelle, denn ich will es so sehen. Ja, ich könnte die vielen Menschen auch anders betrachten, auch die lauten Farbigen, die schubsenden Pariser, die prolligen Marokkaner. Ich könnte sie alle lieb haben, und dann würde ich auch kein Unwohlsein mehr empfinden. Ich könnte den Menschen in die vollgequetschte Metro vorlassen, anstatt mich selber zu quetschen. Der bettelnden Zigeunerin, könnte ich auf ihr „Speaking english?“ antworten „Non. Francais?“ und ihr damit auf nette Art den Wind aus den Segeln nehmen. Ich könnte langsam gehen. Ich könnte lächeln. Tout simplement. Und damit hätte ich wohl den Schalter schon umgelegt.
Aber um nicht nur mit mir zu hadern, muss ich auch mal en schönsten Moment des Tages festhalten. Einen „Schalter-Moment“. Ich stehe am Gare du Nord und warte auf meinen Zug. Ich sehe einen Clochard, der mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen war. Er ist rappeldünn, ein Skelett, und sucht in den Mülleimern nach Essensresten. Ich hatte neulich ein halbes, nicht aufgegessenes Sandwich in der Tasche. Ich hätte es ihm geben wollen. Aber ich habe es nicht gemacht. Mir fehlte der Mut. Warum Mut? Wovor Angst? Angst, dass er es mir um die Ohren haut. Angst, etwas zu machen, worauf die anderen aufmerksam werden.
Heute sah ich ihn also wieder, und das war wohl meine zweite Gelegenheit. Ich hatte einen Kinderriegel in der Tasche, der mir nicht sehr am Herzen lag. Er hing wieder tief in einer Mülltonne drin, als ich mich zu ihm runterbeugte und fragte: „Vous mangez du chocolat?“ Ich weiß gar nicht ob er was geantwortet hat, es war ja auch nicht wirklich eine Frage. Ich gab ihm den Riegel und ging ein paar Meter weg. Ich beobachtete ihn. Er lehnte sich an die Tonne, und packte den Riegel gleich aus. Das Papier warf er in den Mülleimer und er aß, nicht mal sehr hektisch und ausgehungert, sondern fast anmutig. Als er ihn auf hatte, beugte er sich wieder in den Mülleimer, und angelte einen Becher heraus, nahm den Deckel ab und trank den letzen Schluck, der wohl noch darin war.
Ich kamenTränen in die Augen.
Ich freute mich, dass ich mich getraut habe, aber gleichzeitig tat er mir so leid. Wie anders sieht sein Leben aus! Wie schmeckt ein Schokoriegel, wenn man seit Tagen nichts mehr gegessen hat!? Dieser Mann führt das Leben eines Tieres, immer auf Nahrungssuche. Mit dem Unterschied, dass das Tier nicht am Rande steht und von den anderen missachtet wird.
Und dass das Tier in den meisten Fällen so was wie eine Familie hat.
Ich bin froh, dass ich mit jedem Kilometer Paris ferner, und Köln näher komme. Ich weiß nicht, wem ich dafür die Schuld geben soll. Paris oder mir. Ist Paris einfach schrecklich laut, dreckig, hektisch, vollgestopft, stereotyp und ermüdend, oder will ich Paris so sehen? Macht die Stadt mich missmutig, angespannt, gestresst und leicht ängstlich, oder kommt das aus meiner Sicht auf die Stadt. Gibt es da wieder nur einen Schalter, den ich umlegen könnte? Lauter Fragen, auf die ich die Antworten ehrlich gesagt, bereits kenne. Ja, ich bin Schuld, dass ich Paris ins schlechte Licht stelle, denn ich will es so sehen. Ja, ich könnte die vielen Menschen auch anders betrachten, auch die lauten Farbigen, die schubsenden Pariser, die prolligen Marokkaner. Ich könnte sie alle lieb haben, und dann würde ich auch kein Unwohlsein mehr empfinden. Ich könnte den Menschen in die vollgequetschte Metro vorlassen, anstatt mich selber zu quetschen. Der bettelnden Zigeunerin, könnte ich auf ihr „Speaking english?“ antworten „Non. Francais?“ und ihr damit auf nette Art den Wind aus den Segeln nehmen. Ich könnte langsam gehen. Ich könnte lächeln. Tout simplement. Und damit hätte ich wohl den Schalter schon umgelegt.
Aber um nicht nur mit mir zu hadern, muss ich auch mal en schönsten Moment des Tages festhalten. Einen „Schalter-Moment“. Ich stehe am Gare du Nord und warte auf meinen Zug. Ich sehe einen Clochard, der mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen war. Er ist rappeldünn, ein Skelett, und sucht in den Mülleimern nach Essensresten. Ich hatte neulich ein halbes, nicht aufgegessenes Sandwich in der Tasche. Ich hätte es ihm geben wollen. Aber ich habe es nicht gemacht. Mir fehlte der Mut. Warum Mut? Wovor Angst? Angst, dass er es mir um die Ohren haut. Angst, etwas zu machen, worauf die anderen aufmerksam werden.
Heute sah ich ihn also wieder, und das war wohl meine zweite Gelegenheit. Ich hatte einen Kinderriegel in der Tasche, der mir nicht sehr am Herzen lag. Er hing wieder tief in einer Mülltonne drin, als ich mich zu ihm runterbeugte und fragte: „Vous mangez du chocolat?“ Ich weiß gar nicht ob er was geantwortet hat, es war ja auch nicht wirklich eine Frage. Ich gab ihm den Riegel und ging ein paar Meter weg. Ich beobachtete ihn. Er lehnte sich an die Tonne, und packte den Riegel gleich aus. Das Papier warf er in den Mülleimer und er aß, nicht mal sehr hektisch und ausgehungert, sondern fast anmutig. Als er ihn auf hatte, beugte er sich wieder in den Mülleimer, und angelte einen Becher heraus, nahm den Deckel ab und trank den letzen Schluck, der wohl noch darin war.
Ich kamenTränen in die Augen.
Ich freute mich, dass ich mich getraut habe, aber gleichzeitig tat er mir so leid. Wie anders sieht sein Leben aus! Wie schmeckt ein Schokoriegel, wenn man seit Tagen nichts mehr gegessen hat!? Dieser Mann führt das Leben eines Tieres, immer auf Nahrungssuche. Mit dem Unterschied, dass das Tier nicht am Rande steht und von den anderen missachtet wird.
Und dass das Tier in den meisten Fällen so was wie eine Familie hat.
Montag, 14. September 2009
Was ich sehe
Meine Begeisterung für die Stadt, deren Name träumen lässt, ist irgendwie verschwunden. Ich finde sie nicht wieder. Obwohl ich an den schönsten Ecken nach ihr gesucht habe. Am Place des Vosges, im Innenhof des schönen schwedischen Kulturinstituts, in meinem Lieblingskaufhaus, sie bleibt unauffindbar.
Die besonderen Momente, die ich manchmal hier erlebe, spielten sich dort auch nicht ab. Doch, einen gab es. Im Bus. Mittlerweile fast mein Lieblings-Ort in Paris. Schön langsam wird man an allem vorbeigefahren. Ist mittendrin, so eng sind manchmal die Strassen, so nah die Fußgänger und das Leben vor der Scheibe. Die Busfahrer sind erstaunlich freundlich und die Passagiere im Bus wirken entspannt. Darum nehmen sie wohl auch den Bus. Wären sie gehetzt nähmen sie die schnelle Metro.
Ich steige also in den Bus, zusammen mit anderen. Der Bus ist dreiviertel voll. Ich sitze und neben mir steuern zwei ältere Menschen auf die Sitzbank an. Sie kommt von hinten, er von vorne. Sie lässt ihn vor. Er zögert. Will durchrutschen ans Fenster, schaut aber noch um sich nach einem, ihm sympathischeren Platz. „Ah non, je vais là,“ sagt er und will sich an ihr vorbeidrücken an einen Platz weiter hinten. Dann überlegt er es sich noch mal und will doch auf die Sitzbank neben mich, wo die Frau immer noch von seinen Launen hin und herbewegt wird. Sie lässt ihn also durchrutschen, sagt aber noch: „C est votre dernier mot?“ Toll!! Ich bin begeistert. „Ist das ihr letztes Wort?“ fragt sie ihn. Nicht kampflustig, ganz sachlich, und damit hat sie vollkommen recht. Das liebe ich an den Parisern. Sie sprechen. Sie sprechen mit Fremden. Das passiert uns doch eher selten. Da muss uns schon jemand auf dem Fuß stehen, bevor wir ihn ansprechen. Ay!
Die besonderen Momente, die ich manchmal hier erlebe, spielten sich dort auch nicht ab. Doch, einen gab es. Im Bus. Mittlerweile fast mein Lieblings-Ort in Paris. Schön langsam wird man an allem vorbeigefahren. Ist mittendrin, so eng sind manchmal die Strassen, so nah die Fußgänger und das Leben vor der Scheibe. Die Busfahrer sind erstaunlich freundlich und die Passagiere im Bus wirken entspannt. Darum nehmen sie wohl auch den Bus. Wären sie gehetzt nähmen sie die schnelle Metro.
Ich steige also in den Bus, zusammen mit anderen. Der Bus ist dreiviertel voll. Ich sitze und neben mir steuern zwei ältere Menschen auf die Sitzbank an. Sie kommt von hinten, er von vorne. Sie lässt ihn vor. Er zögert. Will durchrutschen ans Fenster, schaut aber noch um sich nach einem, ihm sympathischeren Platz. „Ah non, je vais là,“ sagt er und will sich an ihr vorbeidrücken an einen Platz weiter hinten. Dann überlegt er es sich noch mal und will doch auf die Sitzbank neben mich, wo die Frau immer noch von seinen Launen hin und herbewegt wird. Sie lässt ihn also durchrutschen, sagt aber noch: „C est votre dernier mot?“ Toll!! Ich bin begeistert. „Ist das ihr letztes Wort?“ fragt sie ihn. Nicht kampflustig, ganz sachlich, und damit hat sie vollkommen recht. Das liebe ich an den Parisern. Sie sprechen. Sie sprechen mit Fremden. Das passiert uns doch eher selten. Da muss uns schon jemand auf dem Fuß stehen, bevor wir ihn ansprechen. Ay!
Sonntag, 13. September 2009
Wo ich bin
Und es passiert noch was.
Derselbe Raum, aber ein komplett neues Ambiente. In Brüssel steigen plötzlich Massen von Passagieren in unser ruhiges, rotes, Zugwägelchen, wo ich gerade beschlossen hatte, ein wenig die Augen zu schließen. Plötzlich aber sind wieder viele Stimmen um mich. Ich kann mich nur noch zurücksehnen nach französisch sprechenden Rentnern. Auch wenn die nicht so meine Themen besprachen, dann gaben die mir doch ein besseres Gefühl, als die vielen neuen, bunten Passagieren. Was ich von diesen gerade vorrangig mitbekomme, ist eine Stimme, die aus einem rotgeschminkten, dicklippigen Mund kommt. Sie spricht englisch, aber mit starkem Akzent. Manchmal spricht sie auch ein paar französische Worte, aber auch da setzt er sich durch: der afrikanische Akzent. Sie wird ständig angerufen. Vermutlich von einem Mann, der irgendwo in Paris in seiner Wohnung hockt und ganz schön scharf auf diese kleine, schmale Afrikanerin, in ihrem tigergemusterten, hautengen Oberteil, ist. Sie hört nicht auf, ihm zu sagen, dass sie müde ist, erst spät ankommen wird, einen langen Tag hatte, an dem alles schief lief, dass sie müde ist, dass sie heute nicht mehr will.
Nun spricht sie mit ihren Sitznachbarn. Und hier geht das Licht aus. Technisches Problem. Wir stehen immer noch in Brüssel-Zuid. Schon zwanzig Minuten. Ich hoffe, die Afrikanerin mit dem Tag, an dem alles schief lief, bringt ihr Unglück nicht mit in den Zug.
Dass sie müde ist, kann ich ihr nicht wirklich glauben. Lebhaft erzählt sie den Menschen um sich herum aus ihrem Leben. Ich höre keine anderen Stimmen, nur ihre. Sie braucht keinen Gegenspieler für ihr Match.
Ihre Stimme brennt sich in mir fest. Sie erzählt irgendwas von „Tam Tam“, ein Wort, dass für irgendetwas steht. Was, das kann ich leider nicht verstehen. Sie sagt es ständig. Lacht dabei. Diese zwei Worte und ihr Lachen werde ich noch tagelang erinnern können. Wie ein Musikstück, an das man denkt, und gleich mit komplettem Orchester im Ohr hat.
Meinen letzten Blog beendete ich, indem ich sagte: Eine gute Einstimmung auf Paris. Um ehrlich zu sein, das war die romantische Einstimmung auf Paris. Auf das Paris der Touristen, auf das Vorzeige-Paris, das Saubere und Harmonische, das Akkordeon-Paris. Ein Paris, in dem Franzosen leben.
Die Zugatmosphäre ab Brüssel stimmt mich ein, auf das echte Paris. Auf das bunte Paris. Auf das Paris, dass sich Franzosen mit Afrikanern, Marokkanern, Asiaten, teilen. Hier sind sie alle versammelt und so fühlt sich Paris an. Nicht im ersten, zweiten und nicht in den meisten einstelligen Arrondissements. Aber da, wo die blendende Schönheit von Paris aufhört, da fängt das an, was auch zu Paris gehört: ein bunter Ameisenhaufen.
Derselbe Raum, aber ein komplett neues Ambiente. In Brüssel steigen plötzlich Massen von Passagieren in unser ruhiges, rotes, Zugwägelchen, wo ich gerade beschlossen hatte, ein wenig die Augen zu schließen. Plötzlich aber sind wieder viele Stimmen um mich. Ich kann mich nur noch zurücksehnen nach französisch sprechenden Rentnern. Auch wenn die nicht so meine Themen besprachen, dann gaben die mir doch ein besseres Gefühl, als die vielen neuen, bunten Passagieren. Was ich von diesen gerade vorrangig mitbekomme, ist eine Stimme, die aus einem rotgeschminkten, dicklippigen Mund kommt. Sie spricht englisch, aber mit starkem Akzent. Manchmal spricht sie auch ein paar französische Worte, aber auch da setzt er sich durch: der afrikanische Akzent. Sie wird ständig angerufen. Vermutlich von einem Mann, der irgendwo in Paris in seiner Wohnung hockt und ganz schön scharf auf diese kleine, schmale Afrikanerin, in ihrem tigergemusterten, hautengen Oberteil, ist. Sie hört nicht auf, ihm zu sagen, dass sie müde ist, erst spät ankommen wird, einen langen Tag hatte, an dem alles schief lief, dass sie müde ist, dass sie heute nicht mehr will.
Nun spricht sie mit ihren Sitznachbarn. Und hier geht das Licht aus. Technisches Problem. Wir stehen immer noch in Brüssel-Zuid. Schon zwanzig Minuten. Ich hoffe, die Afrikanerin mit dem Tag, an dem alles schief lief, bringt ihr Unglück nicht mit in den Zug.
Dass sie müde ist, kann ich ihr nicht wirklich glauben. Lebhaft erzählt sie den Menschen um sich herum aus ihrem Leben. Ich höre keine anderen Stimmen, nur ihre. Sie braucht keinen Gegenspieler für ihr Match.
Ihre Stimme brennt sich in mir fest. Sie erzählt irgendwas von „Tam Tam“, ein Wort, dass für irgendetwas steht. Was, das kann ich leider nicht verstehen. Sie sagt es ständig. Lacht dabei. Diese zwei Worte und ihr Lachen werde ich noch tagelang erinnern können. Wie ein Musikstück, an das man denkt, und gleich mit komplettem Orchester im Ohr hat.
Meinen letzten Blog beendete ich, indem ich sagte: Eine gute Einstimmung auf Paris. Um ehrlich zu sein, das war die romantische Einstimmung auf Paris. Auf das Paris der Touristen, auf das Vorzeige-Paris, das Saubere und Harmonische, das Akkordeon-Paris. Ein Paris, in dem Franzosen leben.
Die Zugatmosphäre ab Brüssel stimmt mich ein, auf das echte Paris. Auf das bunte Paris. Auf das Paris, dass sich Franzosen mit Afrikanern, Marokkanern, Asiaten, teilen. Hier sind sie alle versammelt und so fühlt sich Paris an. Nicht im ersten, zweiten und nicht in den meisten einstelligen Arrondissements. Aber da, wo die blendende Schönheit von Paris aufhört, da fängt das an, was auch zu Paris gehört: ein bunter Ameisenhaufen.
Wo bin ich?
Viele schreiben ihre Blogs von unterwegs. Ich mach das jetzt auch mal. Ein Reisebericht. Wie langweilig. Mal sehen, was daraus wird. Damit es nicht so langweilig wird, mache ich ein Ratespiel: Wo bin ich? Um mich herum ist es rötlich. Das liegt am Abendrot, aber auch an dem roten Stoff um mich herum. Vor mir, neben mir, und unter meinem Po. Oben ist es grau, auf dem Boden auch. Grauer Teppichboden. Es ist nicht still. Ich höre ständig Stimmen. Obwohl es hier heute überraschend leer ist. Das habe ich so leer noch nicht erlebt. Aber vier Menschen sitzen sich gegenüber und unterhalten sich so, als bemerkten sie gar nicht, dass wir anderen ihnen zuhören können. Die Stimmen sprechen französisch. Hier sind überhaupt viele fremdsprachige Stimmen. Oft kommen Durchsagen. Erst auf deutsch, dann auf französisch, auf holländisch und letztlich, falls immer noch nicht für jeden die richtige Sprache dabei war, auf englisch.
Das war jetzt ein ziemlich guter Hinweis. Ist schon klar geworden, wo ich mich befinde. Ich könnte an der nächsten Station aussteigen, dann wäre ich in einer Kurstadt. Dort, wo Kaiser Karls Gebeine in der Kirche liegen. Vermutlich die zu allererst aufgeführte Stadt im deutschen Städteverzeichnis.
Würde ich weiterfahren bis zum nächsten Halt, und angenommen, es wäre Sonntag, dann könnte ich auf einen riesigen Flohmarkt gehen. Hier heißt er wohl eher Marché aux Puces.
Keine Lust auf Flohmarkt? Dann weiter zum nächsten Stopp. Hier stehen metallische Gerüste herum, hier pieseln kleine Männchen in Brunnen und mehr Tipps braucht es wohl jetzt nicht. Ich fahre aber weiter bis zur Endstation, und die heißt: Paris.
Ich musste ein Weilchen aufhören. Wer das liest, merkt es nicht, außer daran, dass ich vom Themenfluß abkomme. Ich musste aufhören, weil die Landschaft gerade so schön ist. Kaum hinter Aachen ist die Landschaft wunderschön. Hügelig und waldig (waldig-das Wort gibt es nicht, oder?! Gefällt mir aber), Kühe und charmante Bauernhöfe, Hecken, die die Wiesen abteilen und das alles im Abend-Sonnenlicht.
Aber zurück in den Zug. Denn die Stimmung hier gefällt mir, inspiriert. Diese vier Menschen, deren Stimmen ich wie einen ständigen Fluss um mich habe, gehören zwei Paaren. Es sind Franzosen, Renter aus der gut situierten Bildungsschicht. Eigentlich kann es gar nicht anders sein, als das die beiden Männer ihr Berufsleben als Lehrer oder Dozent verbracht haben.
Ihre Frauen vermutlich Hausfrauen, oder halbtags Beschäftigte in einem Büro, immer gerne an der Seite des Ehemannes, um diesen ins Museum, Theater und in den Konzertsaal zu begleiten. Am Tisch spricht man über das gute Essen und gute Restaurants, die man zu besuchen plant. Nach Tisch gibt es einen Cognac für ihn, einen Kräutertee für sie, und man unterhält sich über Kultur. So wie jetzt. Ich höre selten in einer Stunde so viele Namen von Architekten, Malern, Verstorbenen, von Städten und deren Museen und Bauwerken.
Ich habe das Glück auf einen 1A-Steretypen getroffen zu sein. Beigefarbene Jacketts für die Männer und braun karierte Hosen. Koffer in grün mit Lederriemen eingefasst. Die Frauen kann ich leider nicht sehen. Nur hören. Mit hohen Stimmen höre ich: „Oui, oui, oui.“ Oder „Ah ca!“ „Eh oui“. Sie sind eigentlich nur Hintergrundmusik für die Männerworte.
Ich habe einen Riesen-Vorteil. Ich kann die Stimmen ausschalten. Ich höre sie, aber ich muss ihnen nicht zuhören. Würden sie deutsch sprechen, wäre das nicht möglich. Ich kann es wie einen Schalter ein- und ausschalten. Hinhören. Weghören. Arme Franzosen, die hier versammelt sind, die werden die ganze Zeit beschallt. Aber vielleicht haben die auch so einen Schalter.
Oha!! Die Herrschaften stehen auf (zehn Minuten vor Liège). Sind gar keine Franzosen. Belgier. Schade, als französische Bourgeois, passten sie viel besser in meine Clichée-Schublade. Die Stimmen werden mir fehlen. War eine gute Einstimmung auf Paris.
Es wird langsam dunkel. Gleich acht Uhr. Im Dunkeln Zug fahren finde ich schrecklich. Im Hellen wunderbar. Mit der Landschaft ziehen auch meine Gedanken. Manchmal fühle ich mich dabei wie in einem Musikvideo. So als sähe ich mich von außen, und schaue mir zu, wie ich nachdenklich aus dem Fenster schaue.
Wenn es aber dunkel ist, sehe ich nur mich, wenn ich aus dem Fenster schaue. Das sieht längst nicht so schön aus, wie die sich ständig bewegende Landschaft.
Ich muss noch ein wenig volltanken und aus dem Fenster schauen, bevor das Fenster zum Spiegel wird. Kleine Pause also (die wieder niemand merkt).
Vielleicht sollte ich meinen Bericht auch ganz beenden. Wenn man einen blog liest, will man wohl lieber kurze Texte, sonst traut man sich erst gar nicht ran.
Ich kann ja morgen weiter schreiben.
Oder einen neuen Blog beginnen. Dann gibt es einen aus dem hellen Zug mit den französischen Belgiern, und einen aus dem dunklen Zug ohne Bildungsangebot. Mal sehen, was noch kommt...
Das war jetzt ein ziemlich guter Hinweis. Ist schon klar geworden, wo ich mich befinde. Ich könnte an der nächsten Station aussteigen, dann wäre ich in einer Kurstadt. Dort, wo Kaiser Karls Gebeine in der Kirche liegen. Vermutlich die zu allererst aufgeführte Stadt im deutschen Städteverzeichnis.
Würde ich weiterfahren bis zum nächsten Halt, und angenommen, es wäre Sonntag, dann könnte ich auf einen riesigen Flohmarkt gehen. Hier heißt er wohl eher Marché aux Puces.
Keine Lust auf Flohmarkt? Dann weiter zum nächsten Stopp. Hier stehen metallische Gerüste herum, hier pieseln kleine Männchen in Brunnen und mehr Tipps braucht es wohl jetzt nicht. Ich fahre aber weiter bis zur Endstation, und die heißt: Paris.
Ich musste ein Weilchen aufhören. Wer das liest, merkt es nicht, außer daran, dass ich vom Themenfluß abkomme. Ich musste aufhören, weil die Landschaft gerade so schön ist. Kaum hinter Aachen ist die Landschaft wunderschön. Hügelig und waldig (waldig-das Wort gibt es nicht, oder?! Gefällt mir aber), Kühe und charmante Bauernhöfe, Hecken, die die Wiesen abteilen und das alles im Abend-Sonnenlicht.
Aber zurück in den Zug. Denn die Stimmung hier gefällt mir, inspiriert. Diese vier Menschen, deren Stimmen ich wie einen ständigen Fluss um mich habe, gehören zwei Paaren. Es sind Franzosen, Renter aus der gut situierten Bildungsschicht. Eigentlich kann es gar nicht anders sein, als das die beiden Männer ihr Berufsleben als Lehrer oder Dozent verbracht haben.
Ihre Frauen vermutlich Hausfrauen, oder halbtags Beschäftigte in einem Büro, immer gerne an der Seite des Ehemannes, um diesen ins Museum, Theater und in den Konzertsaal zu begleiten. Am Tisch spricht man über das gute Essen und gute Restaurants, die man zu besuchen plant. Nach Tisch gibt es einen Cognac für ihn, einen Kräutertee für sie, und man unterhält sich über Kultur. So wie jetzt. Ich höre selten in einer Stunde so viele Namen von Architekten, Malern, Verstorbenen, von Städten und deren Museen und Bauwerken.
Ich habe das Glück auf einen 1A-Steretypen getroffen zu sein. Beigefarbene Jacketts für die Männer und braun karierte Hosen. Koffer in grün mit Lederriemen eingefasst. Die Frauen kann ich leider nicht sehen. Nur hören. Mit hohen Stimmen höre ich: „Oui, oui, oui.“ Oder „Ah ca!“ „Eh oui“. Sie sind eigentlich nur Hintergrundmusik für die Männerworte.
Ich habe einen Riesen-Vorteil. Ich kann die Stimmen ausschalten. Ich höre sie, aber ich muss ihnen nicht zuhören. Würden sie deutsch sprechen, wäre das nicht möglich. Ich kann es wie einen Schalter ein- und ausschalten. Hinhören. Weghören. Arme Franzosen, die hier versammelt sind, die werden die ganze Zeit beschallt. Aber vielleicht haben die auch so einen Schalter.
Oha!! Die Herrschaften stehen auf (zehn Minuten vor Liège). Sind gar keine Franzosen. Belgier. Schade, als französische Bourgeois, passten sie viel besser in meine Clichée-Schublade. Die Stimmen werden mir fehlen. War eine gute Einstimmung auf Paris.
Es wird langsam dunkel. Gleich acht Uhr. Im Dunkeln Zug fahren finde ich schrecklich. Im Hellen wunderbar. Mit der Landschaft ziehen auch meine Gedanken. Manchmal fühle ich mich dabei wie in einem Musikvideo. So als sähe ich mich von außen, und schaue mir zu, wie ich nachdenklich aus dem Fenster schaue.
Wenn es aber dunkel ist, sehe ich nur mich, wenn ich aus dem Fenster schaue. Das sieht längst nicht so schön aus, wie die sich ständig bewegende Landschaft.
Ich muss noch ein wenig volltanken und aus dem Fenster schauen, bevor das Fenster zum Spiegel wird. Kleine Pause also (die wieder niemand merkt).
Vielleicht sollte ich meinen Bericht auch ganz beenden. Wenn man einen blog liest, will man wohl lieber kurze Texte, sonst traut man sich erst gar nicht ran.
Ich kann ja morgen weiter schreiben.
Oder einen neuen Blog beginnen. Dann gibt es einen aus dem hellen Zug mit den französischen Belgiern, und einen aus dem dunklen Zug ohne Bildungsangebot. Mal sehen, was noch kommt...
Mittwoch, 2. September 2009
Geburtstag
Ich werde wach, und das letzte, was ich noch weiß, ist, dass ich auf meinem tollen neuen Fahrrad fuhr und neben mir fuhr ein Mann auf seinem Rad. Er strampelte recht kräftig und fragte in welchem Gang ich denn unterwegs sei. „Ach, erst im fünften (von acht),“ antworte ich. Er schnauft. Ich bin stolz. Hinter uns nähert sich eine weitere Radfahrerin. Auch sie spricht mich an: „Hey, wie groß bist du?“ Sie meint mich. „Du bist ganz schön groß, oder?“ Sie spricht mit einem französischen Akzent. Ich steige ab, sie auch, und wir stellen fast, dass ich gar nicht so groß bin. Wir stehen vor ihrem Second-Hand-Mode- Laden und sie sagt zu mir: „Ich habe ein Paar Söckchen für dich. Die passen sonst niemandem. Die sind ganz bunt.“ Bunte Socken trage ich nicht. Ich gehe mit ihr in den Laden. Die Frau ist nett. Sie findet die Socken nicht, holt eine Kladde hervor und blättert darin. Sie will mein Geburtsdatum wissen: 2. September, sage ich. Heute. Und werde wach.
Es wird langsam hell. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Und die Wettervorhersage auch: ein wolkenloser Himmel verspricht zumindest erste sonnige Stunden an diesem Tag. Meinem Tag, der mir bisher gar nicht so wahnsinnig wichtig erscheint. Immer denkt man, man sei anders als die anderen. Ich habe mich immer gewundert, dass für meine Eltern und Grosseltern der Geburtstag gar nicht mal so bedeutsam war wie für mich. Ich wollte immer am liebsten mit einem Schild um mich herum laufen, auf dem steht: Heute ist mein Geburtstag. Kindern zieht man ja zu diesem Tag auch gerne eine Krone auf. Die könnte ich auch tragen. Eigentlich bis heute. Wenn ich mich gleichzeitig auch lächerlich fühlen würde mit Krönchen. Dennoch ist sie in den Jahren etwas verpufft: die Geburtstags-Euphorie. Klar, als Kind ist Geburtstag was ganz besonderes, als Erwachsener lässt das nach. Nein, nein, nein, bei mir nicht. Da war ich ganz sicher.
Das hätte ich nicht gedacht, dass ich einmal Geburtstage erlebe, an dem ich nicht in jeder Sekunde „Geburtstag! Geburtstag! Geburtstag!“ fühle. Der Tag, an dem dir alles erlaubt ist. Wenn ein Spiel gespielt wird, durftest du anfangen. Wenn du dich dreckig machtest, war es ganz egal. Du konntest an diesem Tag jeglichen Mist machen, du wurdest freigesprochen. Alle hatten dich lieb. So kam es mir zumindest vor. Vielleicht hat deshalb der Reiz des Erwachsenen-Geburtstages nachgelassen: Man hat keine Krone mehr auf. Die anderen haben einen nicht mehr lieb als sonst. Man spielt eben keine Spiele mehr, haut nicht mehr auf Pappmaché-Figuren, bis die Bonbons rausfallen, zieht nicht mehr sein Lieblingssommerkleid an, auch wenn es draußen 15 Grad sind, UND: man bläst keine Kerzen mehr aus. Hey, was ist das eigentlich für eine blöde Entwicklung?! Wann hat man aufgehört Kerzen auf den Kuchen zu stellen? Nur weil man plötzlich über 30 Kerzen auf den Kuchen quetschen müsste? Hey, dann soll der Kuchen halt größer werden.
Das ist es! Ich habe verstanden, warum das Geburtstagsgefühl verschwindet. Es liegt nicht an unserer Unfähigkeit die kindliche Freude zu entwickeln. Wir werden einfach nicht mehr „hochgelebt“. „Hoch, soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Hoch! Hoch!“ sang man im Kindergarten und wurde auf seinem Stühlchen in die Luft gehoben. Ja, macht man das mit Erwachsenen??? Warum nicht? Kein Wunder, dass wir dem kindlichen Geburtstagsgefühl nachtrauern. Wenn ich mal Kinder habe, dann bekommen die auch mit 40 noch ne Torte, und ein Geburtstagsritual, dass nur uns gehört, und dass wir solange wir gemeinsam Geburtstag feiern können, und es wollen, zelebrieren! So!
Das hätte ich verstanden. Ich werde jetzt aus diesem Bett aussteigen und mich auf den Weg an den See machen. Da ist zwar niemand, der mich hochleben lässt, aber dort lasse ich erstmal die Welt hochleben. Ich kann ja den Vögeln zuzwitschern, dass heute mein Geburtstag ist. Aber ich glaube sie wissen das schon. Tiere spüren so etwas ;)
Es wird langsam hell. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Und die Wettervorhersage auch: ein wolkenloser Himmel verspricht zumindest erste sonnige Stunden an diesem Tag. Meinem Tag, der mir bisher gar nicht so wahnsinnig wichtig erscheint. Immer denkt man, man sei anders als die anderen. Ich habe mich immer gewundert, dass für meine Eltern und Grosseltern der Geburtstag gar nicht mal so bedeutsam war wie für mich. Ich wollte immer am liebsten mit einem Schild um mich herum laufen, auf dem steht: Heute ist mein Geburtstag. Kindern zieht man ja zu diesem Tag auch gerne eine Krone auf. Die könnte ich auch tragen. Eigentlich bis heute. Wenn ich mich gleichzeitig auch lächerlich fühlen würde mit Krönchen. Dennoch ist sie in den Jahren etwas verpufft: die Geburtstags-Euphorie. Klar, als Kind ist Geburtstag was ganz besonderes, als Erwachsener lässt das nach. Nein, nein, nein, bei mir nicht. Da war ich ganz sicher.
Das hätte ich nicht gedacht, dass ich einmal Geburtstage erlebe, an dem ich nicht in jeder Sekunde „Geburtstag! Geburtstag! Geburtstag!“ fühle. Der Tag, an dem dir alles erlaubt ist. Wenn ein Spiel gespielt wird, durftest du anfangen. Wenn du dich dreckig machtest, war es ganz egal. Du konntest an diesem Tag jeglichen Mist machen, du wurdest freigesprochen. Alle hatten dich lieb. So kam es mir zumindest vor. Vielleicht hat deshalb der Reiz des Erwachsenen-Geburtstages nachgelassen: Man hat keine Krone mehr auf. Die anderen haben einen nicht mehr lieb als sonst. Man spielt eben keine Spiele mehr, haut nicht mehr auf Pappmaché-Figuren, bis die Bonbons rausfallen, zieht nicht mehr sein Lieblingssommerkleid an, auch wenn es draußen 15 Grad sind, UND: man bläst keine Kerzen mehr aus. Hey, was ist das eigentlich für eine blöde Entwicklung?! Wann hat man aufgehört Kerzen auf den Kuchen zu stellen? Nur weil man plötzlich über 30 Kerzen auf den Kuchen quetschen müsste? Hey, dann soll der Kuchen halt größer werden.
Das ist es! Ich habe verstanden, warum das Geburtstagsgefühl verschwindet. Es liegt nicht an unserer Unfähigkeit die kindliche Freude zu entwickeln. Wir werden einfach nicht mehr „hochgelebt“. „Hoch, soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Hoch! Hoch!“ sang man im Kindergarten und wurde auf seinem Stühlchen in die Luft gehoben. Ja, macht man das mit Erwachsenen??? Warum nicht? Kein Wunder, dass wir dem kindlichen Geburtstagsgefühl nachtrauern. Wenn ich mal Kinder habe, dann bekommen die auch mit 40 noch ne Torte, und ein Geburtstagsritual, dass nur uns gehört, und dass wir solange wir gemeinsam Geburtstag feiern können, und es wollen, zelebrieren! So!
Das hätte ich verstanden. Ich werde jetzt aus diesem Bett aussteigen und mich auf den Weg an den See machen. Da ist zwar niemand, der mich hochleben lässt, aber dort lasse ich erstmal die Welt hochleben. Ich kann ja den Vögeln zuzwitschern, dass heute mein Geburtstag ist. Aber ich glaube sie wissen das schon. Tiere spüren so etwas ;)
Donnerstag, 13. August 2009
Urlaubstag mit Amélie
Heute. Ein Urlaubstag. Urlaubstage sind für mich Tage, an denen ich mich treiben lasse. Ungeplant. Einfach los und sehen was kommt. Das klappt nicht immer. Es muss aber erstmal einen Plan geben. Nicht den Plan zum Treiben lassen, sondern einen ersten Plan, der aus einem ersten Ort und einer ersten Aktion besteht. Das kann zum Beispiel, ein Gang in die Stadtbücherei sein. Meistens überrasche ich mich dann selber mit meinem Urlaubstag. Er ist entstanden, weil ich offen war. Offen um mein Außen zu betrachten, und offen, um mein Innen zu betrachten. Blabla... will sagen: Ich hab einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte, und ich hatte Lust. Lust habe ich nicht immer. Hab ich Lust auf Rechts oder Links? Lust auf Kaffee oder Eis?
Heute ist mir etwas passiert, was nur ganz selten geschieht: Ich habe gelesen. Eine Stunde lang. Ich war in der Buchhandlung, in der Grossen, schön Eingerichteten, mit den Sofas und dem Fenster zum Dom. Ich wollte ein paar Bücher anlesen und prüfen, ob sie wert sind, sie auf meine Geburtstagswunschliste zu setzen. Eines davon ist es nun nicht mehr wert, weil ich es vor Ort bereits „leer“ gelesen habe. (Mir gefällt die Vorstellung des Leerlesens. Auch wenn die Buchstaben noch da sind, wenn sie gelesen wurden, sie lesen sich doch nie mehr so, wie beim ersten Mal. Man hat etwas gelehrt, verzehrt, etwas Einzigartiges„weg gemacht“).
Es war ein Buch von Amèlie Nothomb, und es heißt „Biographie des Hungers“. Bisher habe ich von ihr höchstens acht Sätze lesen können, dann gab ich auf. Sie war mir fremd.
In diesem Buch aber sprechen wir eine Sprache. Sie geht zurück zu ihrer Kindheit, ihrem Aufwachsen in Japan, China, New York. Vor allem erzählt sie von ihrem unstillbaren Hunger. Sie meint damit den echten Hunger, der sie besonders zu Süßspeisen hinzieht („zu süß" existiert nicht. Das ist genauso als würde man etwas „zu schön“ finden.). Besonders mag ich die Szene, als sie auf der Jagd nach Süßem ist, und dabei in der elterlichen Garage eine Packung Spekulatius findet. Das Knuspern dieser süßen, zimtigen Kekse begeistert sie derart, dass sie sich einen Platz überlegt, der diesem Genuß gerecht wird. Sie läuft mit der Kekspackung unter ihrem Pullover ins Badezimmer, setzt sich aufs Waschbecken und schaut sich im Spiegel bei ihrem Genuss zu. Sie ist sieben Jahre alt, und entdeckt in ihrem Gesicht die Wolllust.
Ihr Hunger ist aber auch der Hunger nach Leben, nach Experimenten, nach Schmecken und Fühlen und Leben und Lachen. Sie hilft beim Wäsche Aufhängen und saugt dabei an den frisch gewaschenen Kleidungsstücken, um sich diesen Duft einzuverleiben.
Sie ist kaum vier Jahre alt und begeistert als ihre japanische Kinderfrau ihr einen Tropfen Pflaumenschnaps gibt. Auf Partys probiert sie an rumstehenden Champagnergläsern und lacht über ihren Kater am nächsten Tag. Mit etwa sieben Jahren findet sie heraus, dass man aus Schnee, Zitrone und Gin eine herrliche Löffelspeise machen kann.
Sie will drei Worte aus der Sprache streichen: baden, Kleidung und leiden. Schöne Dinge, die so unschöne Buchstabenfolgen zu beschreiben versuchen. (Ich frage mich allerdings, ob sie die französischen, die japanischen oder die englischen Worte dafür meint. Sie spricht all diese Sprachen mit wenigen Jahren.
Dieses Buch machte mich froh und heiter. Eine ganze Stunde lang, und es wirkte auch noch nach. Ich möchte Amélie am liebsten kennen lernen. Aber ich würde mich vermutlich unwohl fühlen. Neben so einer Lebefrau.
Heute ist mir etwas passiert, was nur ganz selten geschieht: Ich habe gelesen. Eine Stunde lang. Ich war in der Buchhandlung, in der Grossen, schön Eingerichteten, mit den Sofas und dem Fenster zum Dom. Ich wollte ein paar Bücher anlesen und prüfen, ob sie wert sind, sie auf meine Geburtstagswunschliste zu setzen. Eines davon ist es nun nicht mehr wert, weil ich es vor Ort bereits „leer“ gelesen habe. (Mir gefällt die Vorstellung des Leerlesens. Auch wenn die Buchstaben noch da sind, wenn sie gelesen wurden, sie lesen sich doch nie mehr so, wie beim ersten Mal. Man hat etwas gelehrt, verzehrt, etwas Einzigartiges„weg gemacht“).
Es war ein Buch von Amèlie Nothomb, und es heißt „Biographie des Hungers“. Bisher habe ich von ihr höchstens acht Sätze lesen können, dann gab ich auf. Sie war mir fremd.
In diesem Buch aber sprechen wir eine Sprache. Sie geht zurück zu ihrer Kindheit, ihrem Aufwachsen in Japan, China, New York. Vor allem erzählt sie von ihrem unstillbaren Hunger. Sie meint damit den echten Hunger, der sie besonders zu Süßspeisen hinzieht („zu süß" existiert nicht. Das ist genauso als würde man etwas „zu schön“ finden.). Besonders mag ich die Szene, als sie auf der Jagd nach Süßem ist, und dabei in der elterlichen Garage eine Packung Spekulatius findet. Das Knuspern dieser süßen, zimtigen Kekse begeistert sie derart, dass sie sich einen Platz überlegt, der diesem Genuß gerecht wird. Sie läuft mit der Kekspackung unter ihrem Pullover ins Badezimmer, setzt sich aufs Waschbecken und schaut sich im Spiegel bei ihrem Genuss zu. Sie ist sieben Jahre alt, und entdeckt in ihrem Gesicht die Wolllust.
Ihr Hunger ist aber auch der Hunger nach Leben, nach Experimenten, nach Schmecken und Fühlen und Leben und Lachen. Sie hilft beim Wäsche Aufhängen und saugt dabei an den frisch gewaschenen Kleidungsstücken, um sich diesen Duft einzuverleiben.
Sie ist kaum vier Jahre alt und begeistert als ihre japanische Kinderfrau ihr einen Tropfen Pflaumenschnaps gibt. Auf Partys probiert sie an rumstehenden Champagnergläsern und lacht über ihren Kater am nächsten Tag. Mit etwa sieben Jahren findet sie heraus, dass man aus Schnee, Zitrone und Gin eine herrliche Löffelspeise machen kann.
Sie will drei Worte aus der Sprache streichen: baden, Kleidung und leiden. Schöne Dinge, die so unschöne Buchstabenfolgen zu beschreiben versuchen. (Ich frage mich allerdings, ob sie die französischen, die japanischen oder die englischen Worte dafür meint. Sie spricht all diese Sprachen mit wenigen Jahren.
Dieses Buch machte mich froh und heiter. Eine ganze Stunde lang, und es wirkte auch noch nach. Ich möchte Amélie am liebsten kennen lernen. Aber ich würde mich vermutlich unwohl fühlen. Neben so einer Lebefrau.
Labels:
Amèlie Nothomb,
Urlaubstag
Freitag, 26. Juni 2009
"You can..."
„You can....“
Heute ist wieder so ein Tag..... Ich hatte dieses Gefühl recht lange nicht mehr. Und jetzt wo es wieder da ist, finde ich das schade. Andererseits bleibt es halt auch immer nur ein Gefühl, und das dahinter bleibt immer offen. Dieses Gefühl ist Sehnsucht. Es ist eine Ahnung von dem, was Leben sein kann. Ein Empfinden von allem ist möglich. Und dazu spielen dann auch noch die Geigen im rechten Moment.
Um dieses Gefühls-Süppchen zu kochen bedarf es zweier Zutaten: den frühen Morgen und „herzöffnende“ Musik. Die Musik kommt von Shaina Noll. Ist eine Art Yoga-Musik, meditativ, hell, liebevoll, „herzöffnend“ halt, so abtörnend das auch klingen mag.
Ich hörte die Musik beim Entspannungstraining, und als ich ganz versunken (gib dein Gewicht an die Matte ab...) dalag, drang an mein Ohr nur der Teil eines Satzes „how deeply your connected to my soul“, und mir liefen die Tränen aus den geschlossenen Augen.
Und heute morgen, sechs Uhr dreizehn, höre ich Satzfetzen wie „you can travel any country country where your hard beats… you can live be yourself… you can gather friends around… you can love who you want… everything possible for you… you can be anybody you want to be…the only mesure … is the love you leave behind….” und ich bekomme dieses herrliche Gefühl von MACHEN wollen. Leben und Lieben. Mutig sein und Fallenlassen. Alles ausleben. Grenzenlos. Andersdenken. Andersleben.
In einer Phase, wo ich mit mir hadere, wo das Leben mir manchmal so eng erscheint, ich mir selber so viele Grenzen setze, entfaltet sich dieses Gefühl wie hoffnungsvoller, lustvoller Balsam. Es macht mir Mut, macht mich stark, bestätigt mich in meinen Plänen. Das Leben ist ein Spiel, ein Geschenk, eine Malbuchseite, die ich mit meinen Farben ausmalen kann. Also wage es, denn es gehört gar kein Mut dazu.
Und wenn ich zweifle an der Möglichkeit einen Laden führen zu können, ihn vor allem erst mal finden, einrichten, organisieren, anmelden und eröffnen zu können, dann erinnere ich mich daran, dass es ein Spiel ist. Ich sollte mir vertrauen, mir und meiner Art nachgehen, mit nicht Angst machen lassen von anderen, die anders funktionieren. Ich bin kein Business-Plan-Mensch. Ich schreibe nicht mal Einkaufszettel und verzähle mich schon, wenn ich drei Summen addieren soll. Ich mache viele kleine Fehler, weil ich nicht konzentriert bin. Ich verstehe das ganze organisatorische System nicht. Spricht einer von Vorsteuer und Buchhaltung, dann bekomme ich weiche Knie und taube Ohren. Dennoch, ich will, und wenn doch alles möglich ist, dann ist doch wenigstens ein Versuch möglich. Und wenn ich jeden frühen Morgen erst meditieren muss mit kitschiger, esoterischer „herzöffnender Musik“...
Heute ist wieder so ein Tag..... Ich hatte dieses Gefühl recht lange nicht mehr. Und jetzt wo es wieder da ist, finde ich das schade. Andererseits bleibt es halt auch immer nur ein Gefühl, und das dahinter bleibt immer offen. Dieses Gefühl ist Sehnsucht. Es ist eine Ahnung von dem, was Leben sein kann. Ein Empfinden von allem ist möglich. Und dazu spielen dann auch noch die Geigen im rechten Moment.
Um dieses Gefühls-Süppchen zu kochen bedarf es zweier Zutaten: den frühen Morgen und „herzöffnende“ Musik. Die Musik kommt von Shaina Noll. Ist eine Art Yoga-Musik, meditativ, hell, liebevoll, „herzöffnend“ halt, so abtörnend das auch klingen mag.
Ich hörte die Musik beim Entspannungstraining, und als ich ganz versunken (gib dein Gewicht an die Matte ab...) dalag, drang an mein Ohr nur der Teil eines Satzes „how deeply your connected to my soul“, und mir liefen die Tränen aus den geschlossenen Augen.
Und heute morgen, sechs Uhr dreizehn, höre ich Satzfetzen wie „you can travel any country country where your hard beats… you can live be yourself… you can gather friends around… you can love who you want… everything possible for you… you can be anybody you want to be…the only mesure … is the love you leave behind….” und ich bekomme dieses herrliche Gefühl von MACHEN wollen. Leben und Lieben. Mutig sein und Fallenlassen. Alles ausleben. Grenzenlos. Andersdenken. Andersleben.
In einer Phase, wo ich mit mir hadere, wo das Leben mir manchmal so eng erscheint, ich mir selber so viele Grenzen setze, entfaltet sich dieses Gefühl wie hoffnungsvoller, lustvoller Balsam. Es macht mir Mut, macht mich stark, bestätigt mich in meinen Plänen. Das Leben ist ein Spiel, ein Geschenk, eine Malbuchseite, die ich mit meinen Farben ausmalen kann. Also wage es, denn es gehört gar kein Mut dazu.
Und wenn ich zweifle an der Möglichkeit einen Laden führen zu können, ihn vor allem erst mal finden, einrichten, organisieren, anmelden und eröffnen zu können, dann erinnere ich mich daran, dass es ein Spiel ist. Ich sollte mir vertrauen, mir und meiner Art nachgehen, mit nicht Angst machen lassen von anderen, die anders funktionieren. Ich bin kein Business-Plan-Mensch. Ich schreibe nicht mal Einkaufszettel und verzähle mich schon, wenn ich drei Summen addieren soll. Ich mache viele kleine Fehler, weil ich nicht konzentriert bin. Ich verstehe das ganze organisatorische System nicht. Spricht einer von Vorsteuer und Buchhaltung, dann bekomme ich weiche Knie und taube Ohren. Dennoch, ich will, und wenn doch alles möglich ist, dann ist doch wenigstens ein Versuch möglich. Und wenn ich jeden frühen Morgen erst meditieren muss mit kitschiger, esoterischer „herzöffnender Musik“...
Abonnieren
Kommentare (Atom)