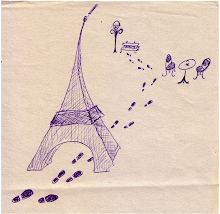Es muss schon etwas Besonderes passieren, wenn ich mal wieder meinen Blog fülle. Das Besondere, was mir passiert, passiert heute der ganzen Menschheit (zumindest dem Teil, der in unserer Zeitrechnung lebt): Silvester. Das alte Jahr wird zum neuen Jahr. Der alte Mensch, der in der letzten Zeit abwartend und möglicherweise lethargisch geworden ist, wird zum neuen Menschen mit neuen Zielen und Ideen im Blut.
Zu diesem Phänomen habe ich beim letzten Jahreswechsel bereits etwas geschrieben. Es soll nicht langweilig werden, darum verkneife ich mir dieses Mal nachdenkliche, möchtegern-schlaue Sätze zu diesem Event.
Ich habe auch letztes Jahr von meinem Weihnachten berichtet. Das möchte ich dieses Jahr wiederholen, denn das wird keine Wiederholung, sondern, wetterbedingt, eine ganz andere Geschichte.
Es war einmal Der Heilige Abend im Jahre 2010. Eigentlich fängt die Geschichte am Heiligen Abend Morgen an. Als ich aus dem Fenster schaue und in meinem Bauch Panikbienen wild schwirren. Schnee. Und zwar mehr als gestern. Mehr als vorgestern. Mehr denn je. Vor meinem Fenster ein Wintersportort. Sehr schön sieht das aus, und ich finde es schade, dass ich nicht, wie es eigentlich natürlich wäre, bei dieser herrlichen Landschaftsveränderung, kindliche Glücksgefühle verspüre. Das mag daran liegen, dass ich als Kind auf den Rücksitz krabbeln konnte mit dem guten Gefühl „Papa macht das schon“. Heute muss ich hinter dem Steuer sitzen und „es schon machen.“ Ich mache es aber nicht. Ich komme nicht weg aus meiner eingeschneiten Parklücke. Und ich will auch nicht weg. Ich will nicht raus aus meiner Schneehöhle und das Auto auf die gruseligen Strassen bewegen. Der Plan ist nach Hause zur Familie zu fahren. Die sind 40 Kilometer von meiner Schneehöhle entfernt. Dazwischen liegen endlos weite Landstrassen, die vermutlich kaum noch als solche zu erkennen sind, weil der Schnee alles in eine große, weiße Fläche verwandelt hat. Dazwischen liegen Gefahren von im Graben landen, im Schnee stecken bleiben, Auto kaputt bis hin zum Erfieren. Und das an Heilig Abend? Nein. Das schaffe ich nicht. Ein Kind kommt, ein Erwachsener geht. Die Rechnung geht auf, aber nicht mit mir. Ich werde sehr traurig, aber mein Entschluss steht fest. Angstbedingt bleibe ich zuhause. Ich rufe meine Eltern zum x-ten Mal an, und teile ihnen meine endgültige Entscheidung mit. Wir legen niedergeschlagen auf. Ich weine sehr viel an diesem Tag. Weihnachten alleine. Das Fest der Liebe abgeschnitten von den Menschen, die man liebt. Ich überlege mir, wie ich den Tag also rumbringen kann. Ich denke an Glühwein, den ich noch im Schrank habe, und studiere das Fernsehprogramm. Ich versuche mich zu trösten, indem ich mir einrede: „Hey, es ist ein Tag wie jeder andere. Ich ignoriere einfach, was die restliche Welt da draußen heute macht. Die Welt, die mutiger war als ich...“
Ich telefoniere mit meinem Freund. Er macht gerade seine Weihnachtseinkäufe. Wie kann das sein? Wie können Menschen sich so normal in der Welt bewegen, die doch heute, zumindest mir, so verschlossen erscheint? Wie kann man irgendwohin gelangen, was außerhalb der Zu-Fuss-Geh-Weite liegt??
Ich kann kaum reden, kann nur mein Schicksal beweinen. Fühle mich so einsam. Mein lieber Freund schimpft mit mir, warum ich denn nicht schon eher angerufen habe. „Ich komme dich abholen. Ich fahre dich zu deinen Eltern.“ Mein Freund befindet sich gerade ca. 30 Kilometer von meinem Wohnort. Er hat Sommerreifen. Ich will gerade „Nein, nein, das ist doch verrückt!“ sagen, da klingelt das Festnetztelefon. Meine Mutter: „Schatz, nimm dir ein Taxi und komm damit her. Wir zahlen es dir.“
Nun muss ich noch mehr weinen. Das ist das echte Fest der Liebe. Entgegen der Vernunft handeln. Die Hauptsache sind die Menschen und ihr Glück. Ihr Zusammensein und ihre Liebe. Ich werde geliebt.
„Du wirst geliebt“ ist übrigens genau die Definition, die ich letztes Silvester beim Bleigießen aus meiner Figur gelesen habe...
Ich wünsche allen Liebe. Denn das ist das Wichtigste im Leben. Und zwar nicht nur geliebt werden, sondern vor allem Liebe geben. Ein wunderschöner, wohliger Kreislauf gegen den Schnee und weitere Katastrophen keine Chance hat.
Freitag, 31. Dezember 2010
Freitag, 27. August 2010
Geteilte Freude
Ich habe mich gefreut! Da hat jemand sofort meinen neuen Text über das kölsche Grundgesetzt entdeckt. Wenn das jemand sofort bemerkt, dann kann das nur bedeuten, dass dieser Jemand oft, wohlmöglich täglich, auf meine blog-Seite schaut. Und ich bekomme das gar nicht mit. Denke, mein blog ist am Verwaisen. Und das Schönste, dieser Jemand ist mein Freund. Ach so, denken jetzt die, die möglicherweise meine Worte hier lesen, ist doch klar, dass dein Freund sich dafür interessiert. Nein, ist gar nicht so klar. Leider, leider, sind Menschen, obwohl sie in Partnerschaft sind, ganz schön allein. Interesse am anderen ist doch so wichtig. Und wenn es Liebe ist, wohl auch ganz selbstverständlich.
Leben teilen...
Ich möchte hier einmal rausbrüllen, wie dankbar ich dafür bin, einen Menschen an meiner Seite zu haben, mit dem ich mich teilen kann. Ich bin nicht mehr nur ich alleine, ich teile mich und meine Sorgen, meine Freuden, meine Fragen, meine Witzchen, mit einem Menschen, der mir zuhört, mir Antworten gibt, über mich lacht, und mich zum Lachen bringt.
Danke!
Leben teilen...
Ich möchte hier einmal rausbrüllen, wie dankbar ich dafür bin, einen Menschen an meiner Seite zu haben, mit dem ich mich teilen kann. Ich bin nicht mehr nur ich alleine, ich teile mich und meine Sorgen, meine Freuden, meine Fragen, meine Witzchen, mit einem Menschen, der mir zuhört, mir Antworten gibt, über mich lacht, und mich zum Lachen bringt.
Danke!
Donnerstag, 26. August 2010
Dat kölsche Grundgesetz
Es ist noch nicht Weihnachten, und ich habe es schon geschafft, das Dokument aufzumachen, und den Willen geformt, etwas zu schreiben.
„Ich freue mich schon darauf, wenn du über das Kölsche Grundgesetz schreibst,“ hörte ich neulich. Huch, wollte ich das?!?
Ja, ich erinnere mich, dass wir über das Kölsche Grundgesetz sprachen, und dabei feststellten, dass das eine tolle Sache ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die halten das Kölsche Grundgesetz für eine typisch kölsche Witzparade. Lockere Sprüche aus dem frechen Mundwerk des optimistischen, lustigen Rheinländers gesprochen. Thekensprüche, die nichts weiter bedeuten, als „Loss mich in Ruh“, oder gar ein Lückenfüller sein können, wenn man nichts anderes zu sagen weiss.
Erzählt mir jemand seine Sorgen, und ich gebe ihm darauf ein „Et kütt wie et kütt“ zurück, dann könnte man darin ein uninteressiertes, wenig einfühlsames Verhalten sehen.
Wobei sich eigentlich etwas ziemlich Esoterisches dahinter verbirgt. Es riecht nach Schicksal, nach einem vorbestimmten Weg, auf den wir keinen Einfluss haben, und darauf Vertrauen ins Leben zu haben. Aber da Esoterik nervt, aber dennoch nicht nur Blödsinn ist, weiss das kölsche Grundgesetz die helfende Kernaussage in herrlich unanstrengendem, fröhlichen Ton ans Ohr des sorgenvollen Menschen zu bringen.
Mir ist besonders hilfreich der Satz „Jeder Jeck es anders.“ Mein Freund schloss an. „und du kannst die Menschen nicht ändern.“ Lass einfach locker! Dann fällt es viel leichter, Menschen, die einem das Leben verdunkeln, einfach sein zu lassen. Ich muss niemanden so zurechtbiegen, wie ich mich dann mit ihm oder ihr wohl fühle. Ich muss kein tolles, harmonisches Verhältnis anstreben, wenn es einfach nicht geht. Der Mensch ist anders, also lass ihn. Toll, das ist eine ganz neue Freiheit!
Ganz besonders gerne mag ich auch „Mäht nix!“ Simpel ausgedrückter Optimismus. Zug hat Verspätung, Regen, Butterbrot fällt auf die Butterseite. Macht doch nichts. Nicht viele Worte, einfach „Mäht nix!“ spüren.
Das letzte der Kölschen Grundgesetze heisst „Drink doch ene met.“
Dieses "Gesetz" könnte ich auch mal mitnehmen, wenn ich gleich auf die Strasse gehe. So wie alle anderen auch...
„Ich freue mich schon darauf, wenn du über das Kölsche Grundgesetz schreibst,“ hörte ich neulich. Huch, wollte ich das?!?
Ja, ich erinnere mich, dass wir über das Kölsche Grundgesetz sprachen, und dabei feststellten, dass das eine tolle Sache ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die halten das Kölsche Grundgesetz für eine typisch kölsche Witzparade. Lockere Sprüche aus dem frechen Mundwerk des optimistischen, lustigen Rheinländers gesprochen. Thekensprüche, die nichts weiter bedeuten, als „Loss mich in Ruh“, oder gar ein Lückenfüller sein können, wenn man nichts anderes zu sagen weiss.
Erzählt mir jemand seine Sorgen, und ich gebe ihm darauf ein „Et kütt wie et kütt“ zurück, dann könnte man darin ein uninteressiertes, wenig einfühlsames Verhalten sehen.
Wobei sich eigentlich etwas ziemlich Esoterisches dahinter verbirgt. Es riecht nach Schicksal, nach einem vorbestimmten Weg, auf den wir keinen Einfluss haben, und darauf Vertrauen ins Leben zu haben. Aber da Esoterik nervt, aber dennoch nicht nur Blödsinn ist, weiss das kölsche Grundgesetz die helfende Kernaussage in herrlich unanstrengendem, fröhlichen Ton ans Ohr des sorgenvollen Menschen zu bringen.
Mir ist besonders hilfreich der Satz „Jeder Jeck es anders.“ Mein Freund schloss an. „und du kannst die Menschen nicht ändern.“ Lass einfach locker! Dann fällt es viel leichter, Menschen, die einem das Leben verdunkeln, einfach sein zu lassen. Ich muss niemanden so zurechtbiegen, wie ich mich dann mit ihm oder ihr wohl fühle. Ich muss kein tolles, harmonisches Verhältnis anstreben, wenn es einfach nicht geht. Der Mensch ist anders, also lass ihn. Toll, das ist eine ganz neue Freiheit!
Ganz besonders gerne mag ich auch „Mäht nix!“ Simpel ausgedrückter Optimismus. Zug hat Verspätung, Regen, Butterbrot fällt auf die Butterseite. Macht doch nichts. Nicht viele Worte, einfach „Mäht nix!“ spüren.
Das letzte der Kölschen Grundgesetze heisst „Drink doch ene met.“
Dieses "Gesetz" könnte ich auch mal mitnehmen, wenn ich gleich auf die Strasse gehe. So wie alle anderen auch...
Freitag, 13. August 2010
Mein Sommerloch
Ist still geworden hier, nicht? Hat mich jemand vermisst? Wollte jemand gerne etwas über Hundekot, Arschbomben und dergleichen erfahren?
Wenn jemand lange nicht in seinem Blog schreibt, wenn man lange Zeit nichts von jemandem liest, der behauptet schreiben würde ihm Spass machen, denn so ein Blog ist ja schliesslich eine freiwillige Sache, dann denkt man erstmal, es geht dem Schreiber nicht gut.
Das kenne ich selber von mir und einer Freundin, auf deren Blog ich regelmässig klicke, und mir zunehmend Sorgen mache, wenn seit Monaten die selbe Überschrift ganz oben steht. Depression, kein Lebenseifer, Leere inside, keine Zeit für Muße, ... Ich komme nur auf schlechte Gedanken bezüglich ihres schriftlichen Schweigens.
Denkt das auch jemand von mir?
Mir geht es gut. Sehr gut. Es ist sehr viel passiert in den letzten Monaten. Das fand mehr im Leben, denn im Schreiben statt. Dennoch ist es irgendwie unfair, das alles für mich zu behalten. Ich hätte die Welt (die, die mich liest), hin und wieder über schöne Dinge informieren können.
Zum Beispiel über den Sommer und die schönen Nebenwirkungen, die er mit sich bringt. Ich hätte erzählen können, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben so braun geworden bin, dass mir jemand sagte: „Sie waren schon in Urlaub, nicht wahr?“ (Bisher hörte ich nur ein gnädiges, von Mutter ausgesprochenes: „Doch, du hast Farbe bekommen.“).
Ich hätte vom Meer berichten können, einer Reise, die teilweise so schöne Orte bereit hielt, dass ich überlegte daraus einen Brigitte-Artikel zu verfassen. Könnte ja mal klappen, einen Artikel schreiben, und einfach einer Zeitschrift vorschlagen. Warum denn nicht?
Hab ich nicht getan. Hab ja nicht mal hier was davon erzählt. Bin ich vielleicht faul geworden?! Ja, vielleicht. Schreiben ist ja auch ein bisschen wir Sport. Man muss sich schon so einen kleinen Tritt geben. Computer anmachen, und das leere Dokument aufrufen, fühlt sich ähnlich an, wie Laufschuhe anziehen. Und hinterher ist man meistens fröhlich. Andererseits, was hat es für einen „Sinn“ hier zu schreiben? Ich weiss nicht, wer und ob überhaupt ich gelesen werde. Wenn ich gelesen werde, dann merke ich nichts davon. Ist auch in Ordnung. Ich habe verstanden, dass es nicht um Bestätigung geht. Manchmal eine Anregung, ein Auftakt zu einem „Gespräch“, „Leserbriefe“ sozusagen, wären natürlich schön. Aber ich bin ja genauso faul, und reagiere auch nicht auf die Blogs anderer.
Das Schreiben über Dinge kann nur einzig und alleine dann gut und sinnvoll sein, wenn ich einfach nur simplen Spass dabei habe. Für mich. Ohne Endziel. Keine Suchen nach Komplimenten und gar dem Wunsch nach „entdeckt werden“. Laufen geht ja auch, ohne dabei ständig vom Strassenrand beklatscht zu werden.
Und es macht mir Spass. Und wieder nehme ich mir vor, doch hin und wieder mein altes Ritual zu pflegen. Morgens Kaffee im Bett und dem Laptop was erzählen, ohne Plan einfach so, weil immer irgendwas raus kommt, und ich dann manchmal freudig überrascht bin, was da rauskommt.
Und ich habe auch schon eine Idee, worüber ich an einem der nächsten Morgende schreiben möchte. Es hat was mit den Kölschen Grundgesetzen zu tun. Denn die rücken immer mehr in den Vordergrund. Aber vielleicht kommt auch wieder alles anders, und ich melde mich das nächste Mal zu Weihnachten und kommentiere dann wieder meine Faulheit.
Faulsein zu dürfen ist doch toll, oder?!
Wenn jemand lange nicht in seinem Blog schreibt, wenn man lange Zeit nichts von jemandem liest, der behauptet schreiben würde ihm Spass machen, denn so ein Blog ist ja schliesslich eine freiwillige Sache, dann denkt man erstmal, es geht dem Schreiber nicht gut.
Das kenne ich selber von mir und einer Freundin, auf deren Blog ich regelmässig klicke, und mir zunehmend Sorgen mache, wenn seit Monaten die selbe Überschrift ganz oben steht. Depression, kein Lebenseifer, Leere inside, keine Zeit für Muße, ... Ich komme nur auf schlechte Gedanken bezüglich ihres schriftlichen Schweigens.
Denkt das auch jemand von mir?
Mir geht es gut. Sehr gut. Es ist sehr viel passiert in den letzten Monaten. Das fand mehr im Leben, denn im Schreiben statt. Dennoch ist es irgendwie unfair, das alles für mich zu behalten. Ich hätte die Welt (die, die mich liest), hin und wieder über schöne Dinge informieren können.
Zum Beispiel über den Sommer und die schönen Nebenwirkungen, die er mit sich bringt. Ich hätte erzählen können, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben so braun geworden bin, dass mir jemand sagte: „Sie waren schon in Urlaub, nicht wahr?“ (Bisher hörte ich nur ein gnädiges, von Mutter ausgesprochenes: „Doch, du hast Farbe bekommen.“).
Ich hätte vom Meer berichten können, einer Reise, die teilweise so schöne Orte bereit hielt, dass ich überlegte daraus einen Brigitte-Artikel zu verfassen. Könnte ja mal klappen, einen Artikel schreiben, und einfach einer Zeitschrift vorschlagen. Warum denn nicht?
Hab ich nicht getan. Hab ja nicht mal hier was davon erzählt. Bin ich vielleicht faul geworden?! Ja, vielleicht. Schreiben ist ja auch ein bisschen wir Sport. Man muss sich schon so einen kleinen Tritt geben. Computer anmachen, und das leere Dokument aufrufen, fühlt sich ähnlich an, wie Laufschuhe anziehen. Und hinterher ist man meistens fröhlich. Andererseits, was hat es für einen „Sinn“ hier zu schreiben? Ich weiss nicht, wer und ob überhaupt ich gelesen werde. Wenn ich gelesen werde, dann merke ich nichts davon. Ist auch in Ordnung. Ich habe verstanden, dass es nicht um Bestätigung geht. Manchmal eine Anregung, ein Auftakt zu einem „Gespräch“, „Leserbriefe“ sozusagen, wären natürlich schön. Aber ich bin ja genauso faul, und reagiere auch nicht auf die Blogs anderer.
Das Schreiben über Dinge kann nur einzig und alleine dann gut und sinnvoll sein, wenn ich einfach nur simplen Spass dabei habe. Für mich. Ohne Endziel. Keine Suchen nach Komplimenten und gar dem Wunsch nach „entdeckt werden“. Laufen geht ja auch, ohne dabei ständig vom Strassenrand beklatscht zu werden.
Und es macht mir Spass. Und wieder nehme ich mir vor, doch hin und wieder mein altes Ritual zu pflegen. Morgens Kaffee im Bett und dem Laptop was erzählen, ohne Plan einfach so, weil immer irgendwas raus kommt, und ich dann manchmal freudig überrascht bin, was da rauskommt.
Und ich habe auch schon eine Idee, worüber ich an einem der nächsten Morgende schreiben möchte. Es hat was mit den Kölschen Grundgesetzen zu tun. Denn die rücken immer mehr in den Vordergrund. Aber vielleicht kommt auch wieder alles anders, und ich melde mich das nächste Mal zu Weihnachten und kommentiere dann wieder meine Faulheit.
Faulsein zu dürfen ist doch toll, oder?!
Freitag, 21. Mai 2010
Morgens, halb sieben, in Ehrenfeld, die Auflösung
Mein Kioskmann ist doof. Er kennt seine Kunden nicht. Nicht mal die Stammkunden. „Machste mit nen Kaffee fertig,“ hörte ich heute morgen wieder, und diesmal habe ich sofort regaiert. Ich fühlte mich ein bisschen wie Amèlie Poulin, die dem Photomaten-Phantom auf die Schliche kommt. Ich ging ans Fenster und wollte ihn sehen. Er soll nicht länger das Morgens-halb-sieben-Mysterium zu sein. Ich bin bereit, ihn mir anzuschauen, die Magie des Nichtwissens zu zerstören. Die ist verrückt, werdet ihr denken. Ja, vielleicht ein bisschen, aber es war so ein herrliches Spiel. Nun ist es aus, denn ich habe ihn gesehen. Der Kaffeemann ist nun nicht mehr die mysteriöse Stimme, sondern hat ein Gesicht. Oder vielmehr eine schwarze Baseballkappe über einem Gesicht, dass ich nicht so gut erkennen konnte. Ich hatte Recht, mit der Vermutung, dass er Handwerker ist. Und dass er in ein Auto steigt, und dann mit seinem Kaffee losfährt. Handwerkskoffer in der einen Hand, Kaffee (schwarz übrigens), in der anderen, genauso hatte ich ihn mir vorgestellt.
Nun kann ich ihn mir nicht mehr vorstellen. Das Geschenkpapier ist ab.
Und von meinem vergesslichen Kioskmann bin ich enttäuscht.
Nun kann ich ihn mir nicht mehr vorstellen. Das Geschenkpapier ist ab.
Und von meinem vergesslichen Kioskmann bin ich enttäuscht.
Freitag, 14. Mai 2010
Morgens, halb sieben, in Ehrenfeld, die Fortsetzung
Jetzt wird`s mir langsam unheimlich. Ich beginne zu verstehen, dass es Menschen gibt, die immer mal wieder auf meinen Blog klicken, den aktuellen Text sehen, der seit Wochen derselbe ist, und dann enttäuscht die Seite zu machen. Ich habe Leser!!
Ich habe enttäuschte Leser?!? „Freundschaften muss man pflegen“. Leserschaften wohl auch?! Also, gibt es nun ein paar Worte. Keine Ahnung wozu, aber es wird Zeit. Auch für mich. Wie kann ich immer wieder behaupten, ich schriebe gerne, wenn seit Wochen „Morgens um zehn vor sieben in Ehrenfeld“ unter dem Schatten im Gemüsebeet geschrieben steht.
Oh, dazu fällt mir was ein, tiens! Ich war neulich beim meinem Kioskmann gegenüber, und wie wir mit der Bierflasche (die mit dem Brasilien-Deckel...) an der Kasse stehen, fällt mir ein, ich könnte ja mal fragen. Aus dem Fenster gucken, habe ich mich nie gewagt, vermutlich wäre das direkte Sehen mir ein Schritt zu weit. Als erstmal eine Beschreibung, oder vielmehr eine Bestätigung einholen. Also frage ich: „Hier kam immer, morgens gegen halb sieben, ein Mann, und wollte, dass du ihm einen Kaffee fertig machst. Der kommt gar nicht mehr?!“ „Was für ein Mann. Kaffee fertig?“ „Wie jetz? Ich höre, bzw. hörte doch morgens immer die Stimme, die ich hörte. Eindeutig ein Mann, der von dir einen Kaffee wollte. Nachher hörte ich eine Autotür zuschlagen.“ Nee, mit dem Auto gibt es keinen. Wenn es eine Frau, wäre wüsste ich sofort wen du meinst,“ kokettiert er, und ich rolle obligatorisch mit dem Augen. „Mach keinen Quatsch!“ Die ganze Welt weiß doch, was morgens um halb sieben in Ehrenfeld passiert (na ja, zumindest ein paar liebe Leser). „Vielleicht stimmt das mit dem Auto auch nicht, vielleicht war das nur zufällig in dem Moment als ich die Stimme hörte, dass irgendwo eine Autotür zuschlug. Aber da war doch definitiv ein Kunde, der regelmässig nen Kaffee wollte!?!“ „Vielleicht der Strassenfeger. Der kommt aber nicht jeden Tag. Der kommt nur dreimal die Woche so früh. Montags, Dienstags und Donnerstags kommt er von rechts. Dann nimmt er `nen Kaffee mit. Wenn er von rechts kommt, dann ist er zwei Stunden später dran. Dann nimmt er keinen Kaffee.“ Ich bin enttäuscht, und ein bisschen wie ein kleines Kind, dem man sagt, unter dem Weihnachtsmannkostüm steckt der Onkel Alfons. „Das haben wir nicht gehört, das Gespräch hat nicht stattgefunden, der Typ ist einfach total vergesslich, und kann sich seine Kunden nicht merken, es gibt ihn den Kaffee-Mann!“ möchte ich meinem Freund beim Rausgehen sagen.
Ich will nicht erwachsen werden.
Ich habe enttäuschte Leser?!? „Freundschaften muss man pflegen“. Leserschaften wohl auch?! Also, gibt es nun ein paar Worte. Keine Ahnung wozu, aber es wird Zeit. Auch für mich. Wie kann ich immer wieder behaupten, ich schriebe gerne, wenn seit Wochen „Morgens um zehn vor sieben in Ehrenfeld“ unter dem Schatten im Gemüsebeet geschrieben steht.
Oh, dazu fällt mir was ein, tiens! Ich war neulich beim meinem Kioskmann gegenüber, und wie wir mit der Bierflasche (die mit dem Brasilien-Deckel...) an der Kasse stehen, fällt mir ein, ich könnte ja mal fragen. Aus dem Fenster gucken, habe ich mich nie gewagt, vermutlich wäre das direkte Sehen mir ein Schritt zu weit. Als erstmal eine Beschreibung, oder vielmehr eine Bestätigung einholen. Also frage ich: „Hier kam immer, morgens gegen halb sieben, ein Mann, und wollte, dass du ihm einen Kaffee fertig machst. Der kommt gar nicht mehr?!“ „Was für ein Mann. Kaffee fertig?“ „Wie jetz? Ich höre, bzw. hörte doch morgens immer die Stimme, die ich hörte. Eindeutig ein Mann, der von dir einen Kaffee wollte. Nachher hörte ich eine Autotür zuschlagen.“ Nee, mit dem Auto gibt es keinen. Wenn es eine Frau, wäre wüsste ich sofort wen du meinst,“ kokettiert er, und ich rolle obligatorisch mit dem Augen. „Mach keinen Quatsch!“ Die ganze Welt weiß doch, was morgens um halb sieben in Ehrenfeld passiert (na ja, zumindest ein paar liebe Leser). „Vielleicht stimmt das mit dem Auto auch nicht, vielleicht war das nur zufällig in dem Moment als ich die Stimme hörte, dass irgendwo eine Autotür zuschlug. Aber da war doch definitiv ein Kunde, der regelmässig nen Kaffee wollte!?!“ „Vielleicht der Strassenfeger. Der kommt aber nicht jeden Tag. Der kommt nur dreimal die Woche so früh. Montags, Dienstags und Donnerstags kommt er von rechts. Dann nimmt er `nen Kaffee mit. Wenn er von rechts kommt, dann ist er zwei Stunden später dran. Dann nimmt er keinen Kaffee.“ Ich bin enttäuscht, und ein bisschen wie ein kleines Kind, dem man sagt, unter dem Weihnachtsmannkostüm steckt der Onkel Alfons. „Das haben wir nicht gehört, das Gespräch hat nicht stattgefunden, der Typ ist einfach total vergesslich, und kann sich seine Kunden nicht merken, es gibt ihn den Kaffee-Mann!“ möchte ich meinem Freund beim Rausgehen sagen.
Ich will nicht erwachsen werden.
Freitag, 9. April 2010
Morgens, zehn vor sieben, in Ehrenfeld
Er ist wieder da!!! Ich hörte seine Stimme wieder. Während ich noch schlafgemütlich die warme Bettdecke knetete und den aufmunternden Vögeln draußen zuhörte, mischte sich eine mir altbekannte Stimme zwischen das Vogelgezwitscher. Und sie hat beinah denselben Effekt: Sie macht Sommerlaune.
Welche Stimme? Was hat sie gesagt? Wieso Sommerlaune? Es ist die Stimme eines Mannes. Ein Mann, den ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie er aussieht, wie alt er ist, was das für ein Auto ist, dass er vor meinem Haus startet, aber ich kenne eine Gewohnheit von ihm. Er trinkt morgens zwischen halb und sieben einen Kaffee, den ihm mein netter Kioskmann gegenüber zubereitet.
„Machste mir nen Kaffee fertig?!“ ist wieder da! Und mit ihm kommen alle Gefühle des letzten Sommers wieder. Ich bilde mir gleich ein, draußen wären bereits 20 Grad und die Welt stünde zu allen Sommeraktivitäten bereit.
„Machste mir nen Sommer fertig!“ ...
Welche Stimme? Was hat sie gesagt? Wieso Sommerlaune? Es ist die Stimme eines Mannes. Ein Mann, den ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie er aussieht, wie alt er ist, was das für ein Auto ist, dass er vor meinem Haus startet, aber ich kenne eine Gewohnheit von ihm. Er trinkt morgens zwischen halb und sieben einen Kaffee, den ihm mein netter Kioskmann gegenüber zubereitet.
„Machste mir nen Kaffee fertig?!“ ist wieder da! Und mit ihm kommen alle Gefühle des letzten Sommers wieder. Ich bilde mir gleich ein, draußen wären bereits 20 Grad und die Welt stünde zu allen Sommeraktivitäten bereit.
„Machste mir nen Sommer fertig!“ ...
Labels:
Kaffee,
Sommer,
Vögelgezwitscher
Freitag, 2. April 2010
Ostern- mal anders
Ostern. Bisher dachte ich, das sei die Gelegenheit, zu der uns klar gemacht wird, dass wir im Grunde alle schlechte Menschen sind. Wir haben Vorurteile, wir schauen nicht mit Liebe und Verständnis, wir sind uneinsichtig, wir schließen uns der schlechten Masse an, anstatt selber zu denken, wir sind bösartig, bis hin zu brutal. So brutal, dass wir einen Menschen nicht nur töten, sondern ihn bloßstellen, ihm heftige Wunden zufügen und uns ein Schauspiel bieten, wo wir uns tagelang an unserer Foltergier ergötzen können.
Und dann passiert etwas, und wir Arschlöcher merken plötzlich, dass wir solche sind. Dass wir jemanden für eine Lüge getötet haben, die gar keine war. Die Ankläger werden zu den Sündern. Und wir schämen uns und besinnen uns auf eine bessere Welt. Wir dürfen verstehen, dass es Menschen gibt, die tragen so viel Liebe in sich, dass sie nicht mal laut werden, wenn es um ihr Leben geht. Sie verzeihen uns sogar noch.
Plötzlich erkenne ich, dass die Geschichte auch mal umgekehrt verstanden werden kann. So eine biblische Geschichte, ist ja immer ein Bild, was uns helfen soll, etwas zu verstehen. Ein bisschen auch Auslegungssache. Sie holt den Menschen da ab, wo er gerade ist. Und darum sehe ich die Ostergeschichte nun noch mal anders. In einem vorhergegangenen Blogbeitrag schreibe ich über Veränderungen. Die wunderschöne Erkenntnis, dass Veränderungen eines Menschen möglich sind.
Mal angenommen der Jesus ist tatsächlich ein Angeber. Er muss ja nicht rum erzählen, dass er Gottes Sohn ist. Er könnte schön bescheiden durch die Welt trapsen und sein gutes Werk tun. Tut er aber nicht. Tun wir Menschen aber nicht. Wir sind oft ganz schön ätzend. Wollen gesehen werden, plustern uns auf, brauchen Bestätigung, sehen mehr uns selbst, als die anderen. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, an dem uns das bewusst wird. Und anderen wird es auch bewusst. Sie klagen uns an, werfen uns Schlechtes vor, setzen uns einen Spiegel vor. Und in dem verkehrt herum verstandenen Ostermärchen verstehen wir das plötzlich. Wir erkennen endlich, dass wir scheiße sind. Und wir schämen uns. Wir werden ans Kreuz genagelt, und geben keine Widerworte. Wir haben Schmerzen. Wir leiden an uns selbst. Tagelang, vielleicht noch länger, hängen wir am Kreuz, nackt, blutend, hilflos. Irgendwann kommt kein Blut mehr, wir haben alles ausgeschwemmt. Wir werden heruntergenommen von dem anklagenden Kreuz, und irgendwo hingelegt, wo wir in Frieden sind. Die Scham ist weg. Wir haben begriffen. Wir hingen drei Tage an unserem eigenen Kreuz, haben verstanden und gebüßt. Der Mensch, der wir waren ist gestorben. Ein neuer macht sich langsam präsent. Sein Blut fliesst bereits in unserem geschundenen Körper. Immer spürbarer wird er , immer mehr kommt er zum Leben. Und irgendwann ist die Kraft wieder da. Soviel Kraft, dass wir sogar den Stein hinfort rollen können. Der Stein, die vielleicht letzte Hürde, um uns zu beweisen. Sind wir tatsächlich stark geworden? Können wir einen Stein ins Rollen bringen. Uns selbst als neuen Menschen? Ja, wir können.
Und plötzlich, wie ich mir meinen Text noch mal durchlese, merke ich: Man muss die Ostergeschichte gar nicht anders herum verstehen. So wie sie ist, sagt sie genau das aus: Veränderungen im Menschen sind möglich. Wir, als Ankläger, als Ans-Kreuz-Nagler, verhalten uns scheiße. Wir erkennen das und schämen uns maßlos, denn es geht hier an die Substanz. Es geht um Liebe. Um Menschlichkeit. Um Intelligenz. Wir werden wach und merken, wir haben von all dem keinen Funken ins uns. Aber uns wird verziehen. Wir bekommen die Möglichkeit neu anzufangen. Und jetzt erst können wir durchstarten, denn die Energie der Scham, des Erschreckens über uns selbst ist so gross, dass sie uns trägt durch die Herausforderungen des neuen Lebens. Einem Leben, in dem es mehr Liebe, mehr Menschlichkeit, mehr Intelligenz geben soll.
Weihnachten ist das Fest, wo die Liebe geboren wird. Ostern die Gelegenheit zu zeigen, ob wir es begriffen haben.
Und dann passiert etwas, und wir Arschlöcher merken plötzlich, dass wir solche sind. Dass wir jemanden für eine Lüge getötet haben, die gar keine war. Die Ankläger werden zu den Sündern. Und wir schämen uns und besinnen uns auf eine bessere Welt. Wir dürfen verstehen, dass es Menschen gibt, die tragen so viel Liebe in sich, dass sie nicht mal laut werden, wenn es um ihr Leben geht. Sie verzeihen uns sogar noch.
Plötzlich erkenne ich, dass die Geschichte auch mal umgekehrt verstanden werden kann. So eine biblische Geschichte, ist ja immer ein Bild, was uns helfen soll, etwas zu verstehen. Ein bisschen auch Auslegungssache. Sie holt den Menschen da ab, wo er gerade ist. Und darum sehe ich die Ostergeschichte nun noch mal anders. In einem vorhergegangenen Blogbeitrag schreibe ich über Veränderungen. Die wunderschöne Erkenntnis, dass Veränderungen eines Menschen möglich sind.
Mal angenommen der Jesus ist tatsächlich ein Angeber. Er muss ja nicht rum erzählen, dass er Gottes Sohn ist. Er könnte schön bescheiden durch die Welt trapsen und sein gutes Werk tun. Tut er aber nicht. Tun wir Menschen aber nicht. Wir sind oft ganz schön ätzend. Wollen gesehen werden, plustern uns auf, brauchen Bestätigung, sehen mehr uns selbst, als die anderen. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, an dem uns das bewusst wird. Und anderen wird es auch bewusst. Sie klagen uns an, werfen uns Schlechtes vor, setzen uns einen Spiegel vor. Und in dem verkehrt herum verstandenen Ostermärchen verstehen wir das plötzlich. Wir erkennen endlich, dass wir scheiße sind. Und wir schämen uns. Wir werden ans Kreuz genagelt, und geben keine Widerworte. Wir haben Schmerzen. Wir leiden an uns selbst. Tagelang, vielleicht noch länger, hängen wir am Kreuz, nackt, blutend, hilflos. Irgendwann kommt kein Blut mehr, wir haben alles ausgeschwemmt. Wir werden heruntergenommen von dem anklagenden Kreuz, und irgendwo hingelegt, wo wir in Frieden sind. Die Scham ist weg. Wir haben begriffen. Wir hingen drei Tage an unserem eigenen Kreuz, haben verstanden und gebüßt. Der Mensch, der wir waren ist gestorben. Ein neuer macht sich langsam präsent. Sein Blut fliesst bereits in unserem geschundenen Körper. Immer spürbarer wird er , immer mehr kommt er zum Leben. Und irgendwann ist die Kraft wieder da. Soviel Kraft, dass wir sogar den Stein hinfort rollen können. Der Stein, die vielleicht letzte Hürde, um uns zu beweisen. Sind wir tatsächlich stark geworden? Können wir einen Stein ins Rollen bringen. Uns selbst als neuen Menschen? Ja, wir können.
Und plötzlich, wie ich mir meinen Text noch mal durchlese, merke ich: Man muss die Ostergeschichte gar nicht anders herum verstehen. So wie sie ist, sagt sie genau das aus: Veränderungen im Menschen sind möglich. Wir, als Ankläger, als Ans-Kreuz-Nagler, verhalten uns scheiße. Wir erkennen das und schämen uns maßlos, denn es geht hier an die Substanz. Es geht um Liebe. Um Menschlichkeit. Um Intelligenz. Wir werden wach und merken, wir haben von all dem keinen Funken ins uns. Aber uns wird verziehen. Wir bekommen die Möglichkeit neu anzufangen. Und jetzt erst können wir durchstarten, denn die Energie der Scham, des Erschreckens über uns selbst ist so gross, dass sie uns trägt durch die Herausforderungen des neuen Lebens. Einem Leben, in dem es mehr Liebe, mehr Menschlichkeit, mehr Intelligenz geben soll.
Weihnachten ist das Fest, wo die Liebe geboren wird. Ostern die Gelegenheit zu zeigen, ob wir es begriffen haben.
Labels:
Jesus,
Menschlichkeit,
Ostern
Mittwoch, 24. März 2010
Arschbomben-Gedanken
„Kannst du nicht mal was über die „Arschbombe“ schreiben?“ fragte mich mein Freund. Klar, warum nicht, wenn mir was zu Hundekot einfällt, dann ist Arschbombe geradezu ein Geschenk für mich. Denn Arschbombe ist mehr als nur Arschbombe.
Die Arschbombe gehörte bisher nicht zu meinem Leben. Weil ich nicht ins Schwimmbad gehe, weil ich auch im Meer eher der nur-Füsse-am-Rand-Platscher bin, und in unbekannte Gewässer sowieso schon keinen Sprung ins Ungewisse mache. Ich weiß nicht, wie es ist, bei 30 Grad, 10 Meter vom Beckenrand zu stehen, mit glühendem Kopf und rasendem Herz, Anlauf zu nehmen, den Rand anzuvisieren, mit Schwung abzuspringen, fliegen, den ersten Pozipfel auf s Wasser klatschen zu spüren und gleich hinterher zu sinken, tief und gurgelnd Richtung Schwimmbeckenboden. Auftauchen, die Blicke in Empfang nehmen, die lachenden der Gutgelaunten und die anklagenden der Muffelmenschen.
Es scheint mehr dahinter zu sein, als nur ein Hüpfer ins erfrischende Nass. Die Arschbombe wird soziologisch, denn sie spaltet die Bevölkerung in Optimisten und Pessimisten. Die Arschbombe wird psychologisch, denn sie wird, alleine in der Vorstellung, ein Gefühl für mich. Ein Lebensgefühl.
„Ich will eine Arschbombe ins Leben machen,“ sagte ich. Kopfüber ins Leben springen, das gab es schon. Kopfüber find ich langweilig. Arschbombe ist irgendwie lustiger. Ein Kopfsprung ist so elegant und zart, vor allem ist der Köpper ein Alleingang. Der Kopf auf der Brust, man ist bei sich, schwungvoll und zielstrebig. Das ist schön, aber die Arschbombe kann noch mehr. Sie führt auch zum Ziel, aber mit den Armen in der Luft, die Freude zeigen und teilen. Wer kann schon lachen, wenn er einen Köpper macht?! Der Po rausgestreckt, wie eine kleine Provokation an das Schlechtgelaunte in der Welt. Mit meinem Hintern zerdrücke ich die Ernsthaftigkeit.
Es wird Frühling, es wird Sommer. Arschbombenzeit!
Wenn nicht jetzt, wann dann!...
Die Arschbombe gehörte bisher nicht zu meinem Leben. Weil ich nicht ins Schwimmbad gehe, weil ich auch im Meer eher der nur-Füsse-am-Rand-Platscher bin, und in unbekannte Gewässer sowieso schon keinen Sprung ins Ungewisse mache. Ich weiß nicht, wie es ist, bei 30 Grad, 10 Meter vom Beckenrand zu stehen, mit glühendem Kopf und rasendem Herz, Anlauf zu nehmen, den Rand anzuvisieren, mit Schwung abzuspringen, fliegen, den ersten Pozipfel auf s Wasser klatschen zu spüren und gleich hinterher zu sinken, tief und gurgelnd Richtung Schwimmbeckenboden. Auftauchen, die Blicke in Empfang nehmen, die lachenden der Gutgelaunten und die anklagenden der Muffelmenschen.
Es scheint mehr dahinter zu sein, als nur ein Hüpfer ins erfrischende Nass. Die Arschbombe wird soziologisch, denn sie spaltet die Bevölkerung in Optimisten und Pessimisten. Die Arschbombe wird psychologisch, denn sie wird, alleine in der Vorstellung, ein Gefühl für mich. Ein Lebensgefühl.
„Ich will eine Arschbombe ins Leben machen,“ sagte ich. Kopfüber ins Leben springen, das gab es schon. Kopfüber find ich langweilig. Arschbombe ist irgendwie lustiger. Ein Kopfsprung ist so elegant und zart, vor allem ist der Köpper ein Alleingang. Der Kopf auf der Brust, man ist bei sich, schwungvoll und zielstrebig. Das ist schön, aber die Arschbombe kann noch mehr. Sie führt auch zum Ziel, aber mit den Armen in der Luft, die Freude zeigen und teilen. Wer kann schon lachen, wenn er einen Köpper macht?! Der Po rausgestreckt, wie eine kleine Provokation an das Schlechtgelaunte in der Welt. Mit meinem Hintern zerdrücke ich die Ernsthaftigkeit.
Es wird Frühling, es wird Sommer. Arschbombenzeit!
Wenn nicht jetzt, wann dann!...
Labels:
Arschbombe,
Kopfsprung,
Schwimmbad
Donnerstag, 18. März 2010
Frühlingsmorgens in der Kölner Südstadt
Frühlings-Schlendrian
„Frühling- Wo bleibst du?“ steht bei "Paul`s Schwester" (wer jetzt denkt: Paul kenne ich nicht. Erst recht nicht seine Schwester, dem sei gesagt: Kann man kennenlernen. Severinskirchplatz. Ein Suchspiel! ☺ )
Gestern ist er gekommen. Der erste Tag, an dem alles anders war. Man plötzlich früh morgens wach wird, und nicht mal grummelt, dass man aufstehen muss. Die Luft von draußen ist anders (so man ein Fenster aufhat), die Geräusche klingen wärmer und gedämpfter, die Winterstille ist vorbei, muntere Vogelstimmen machen einem Lust auf den Tag. Beim Kaffee hat man kaum Ruhe, überlegt schon fast das Getränk in einen Thermobecher zu füllen und draußen zu trinken, während man eine Station später in die U-Bahn steigt. Oder gar das Rad nehmen heute? Zum ersten Mal wieder?! Aber das Schönste kommt erst noch: Das Anziehen. Man macht mal wieder den Schrank auf, anstatt wieder und wieder die Klamotten vom Vortag und Vorvortag zu nehmen. Die Klamotten der letzten Wochen scheinen veraltert. Die Strumpfhose weglassen, die nackten Beine an der Hose spüren. Dem Hals mal wieder etwas Luft geben. Aber das Allerschönste: Die Winterjacke bleibt am Haken. Endlich nicht mehr sich verschnüren wie ein Päckchen, einfach lässig die „Übergangsjacke“ übergeworfen. Gestern sah man gar schon Menschen, die diese am Finger baumeln, über der Schulter trugen. Man sah gestern sowieso Dinge, die man Monate nicht sah: Menschen, die langsam gehen. Menschen, die wohl gedopt von diesem Gefühl Frühling, einander anschauen, wenn sie auf der Strasse vorübergehen, und ein unsichtbares Augenzwinkern zu tauschen scheinen, dass sagt: „Toll, nicht!? Endlich!“
Ich finde in der Südstadt ist der Frühling besonders schön. Sollte ich Nicht-Kölnern einen Ort empfehlen, an den sie an den ersten, diesen magischen Frühlingstagen gehen sollten, dann wäre das die Südstadt. Ich würde ihnen sagen: „Macht euch früh auf den Weg. Ohne Frühstück, ohne Kaffee. Denn den Ersten solltet ihr bereits draußen nehmen. Im Stehen, mit redseligen, bunt gemischten Menschen aus dem Veedel um euch herum. Dafür gibt es zwei Varianten. Beide Welten voneinander entfernt, aber auch wieder nicht.
Variante 1: Formula Uno. Caffé Latte trinken bei den Italienern. Im besten Fall hin und her pendeln zwischen drinnen und draußen. Auf dem Bürgersteig sitzend die morgendliche Welt beobachten, die in dieser kleinen sympathischen Strasse so gemütlich ist, Kaffee trinken, vielleicht die Morgenzigarette rauchen, die Morgenzeitung blättern, gähnen. Hineingehen, noch einen Caffé bestellen, dabei mit einem Menschen an der Theke ins Gespräch kommen, den zweiten Kaffee von mehr Worten begleitet an der Bar trinken, langsam munter werden.
Variante 2: Den ersten Kaffee bei Bäckerei Merzenich nehmen. Da geht man nicht wegen dem guten Kaffee hin. Den hast du in Variante 1. Aber bei Merzenich hast du den perfekten Beobachtungsposten. Hier siehst du alle und alles. Den Frühaufsteher-Rentner, der sich hier zu seiner Frühaufsteher-Frühstückrunde trifft. Menschen, die wohl auf etwas warten (zum Beispiel auf einen Arztbesuch), und dies hier bei einer Tasse Kaffee und einem Käsebrötchen tun. Bei Merzenich bist du inmitten von allen. Handwerker, die ein Fleischwurstbrötchen verschlingen, Schulkinder, die eine Capri Sonne kaufen, Mütter, die ihren Kleinen ein Rosinenbrötchen in die Hand drücken. Und du bist am Verkehrsknotenpunkt. Direkt am Chlodwigplatz, hier muss jeder vorbei. Es ist ein schönes Gefühl die Menschen, die zur Arbeit müssen, von seinem Stehtischchen aus beobachten zu können und zu wissen: Ich muss nicht zur Arbeit. Ich kann hier stehen und euch zuschauen. Das ist das Merzenich-Gefühl.
Nachdem Variante 1 oder 2 hinter einem liegt, könnte man erstmal ein paar Schritte gehen. Vom Formula Uno aus zum Beispiel in Richtung ....
Wenn es dann langsam Zeit für s Frühstück wird, fallen mir wieder mindestens zwei Varianten ein. Die gibt es vielleicht morgen. Hoffentlich auch noch ein Frühlingstag.
„Frühling- Wo bleibst du?“ steht bei "Paul`s Schwester" (wer jetzt denkt: Paul kenne ich nicht. Erst recht nicht seine Schwester, dem sei gesagt: Kann man kennenlernen. Severinskirchplatz. Ein Suchspiel! ☺ )
Gestern ist er gekommen. Der erste Tag, an dem alles anders war. Man plötzlich früh morgens wach wird, und nicht mal grummelt, dass man aufstehen muss. Die Luft von draußen ist anders (so man ein Fenster aufhat), die Geräusche klingen wärmer und gedämpfter, die Winterstille ist vorbei, muntere Vogelstimmen machen einem Lust auf den Tag. Beim Kaffee hat man kaum Ruhe, überlegt schon fast das Getränk in einen Thermobecher zu füllen und draußen zu trinken, während man eine Station später in die U-Bahn steigt. Oder gar das Rad nehmen heute? Zum ersten Mal wieder?! Aber das Schönste kommt erst noch: Das Anziehen. Man macht mal wieder den Schrank auf, anstatt wieder und wieder die Klamotten vom Vortag und Vorvortag zu nehmen. Die Klamotten der letzten Wochen scheinen veraltert. Die Strumpfhose weglassen, die nackten Beine an der Hose spüren. Dem Hals mal wieder etwas Luft geben. Aber das Allerschönste: Die Winterjacke bleibt am Haken. Endlich nicht mehr sich verschnüren wie ein Päckchen, einfach lässig die „Übergangsjacke“ übergeworfen. Gestern sah man gar schon Menschen, die diese am Finger baumeln, über der Schulter trugen. Man sah gestern sowieso Dinge, die man Monate nicht sah: Menschen, die langsam gehen. Menschen, die wohl gedopt von diesem Gefühl Frühling, einander anschauen, wenn sie auf der Strasse vorübergehen, und ein unsichtbares Augenzwinkern zu tauschen scheinen, dass sagt: „Toll, nicht!? Endlich!“
Ich finde in der Südstadt ist der Frühling besonders schön. Sollte ich Nicht-Kölnern einen Ort empfehlen, an den sie an den ersten, diesen magischen Frühlingstagen gehen sollten, dann wäre das die Südstadt. Ich würde ihnen sagen: „Macht euch früh auf den Weg. Ohne Frühstück, ohne Kaffee. Denn den Ersten solltet ihr bereits draußen nehmen. Im Stehen, mit redseligen, bunt gemischten Menschen aus dem Veedel um euch herum. Dafür gibt es zwei Varianten. Beide Welten voneinander entfernt, aber auch wieder nicht.
Variante 1: Formula Uno. Caffé Latte trinken bei den Italienern. Im besten Fall hin und her pendeln zwischen drinnen und draußen. Auf dem Bürgersteig sitzend die morgendliche Welt beobachten, die in dieser kleinen sympathischen Strasse so gemütlich ist, Kaffee trinken, vielleicht die Morgenzigarette rauchen, die Morgenzeitung blättern, gähnen. Hineingehen, noch einen Caffé bestellen, dabei mit einem Menschen an der Theke ins Gespräch kommen, den zweiten Kaffee von mehr Worten begleitet an der Bar trinken, langsam munter werden.
Variante 2: Den ersten Kaffee bei Bäckerei Merzenich nehmen. Da geht man nicht wegen dem guten Kaffee hin. Den hast du in Variante 1. Aber bei Merzenich hast du den perfekten Beobachtungsposten. Hier siehst du alle und alles. Den Frühaufsteher-Rentner, der sich hier zu seiner Frühaufsteher-Frühstückrunde trifft. Menschen, die wohl auf etwas warten (zum Beispiel auf einen Arztbesuch), und dies hier bei einer Tasse Kaffee und einem Käsebrötchen tun. Bei Merzenich bist du inmitten von allen. Handwerker, die ein Fleischwurstbrötchen verschlingen, Schulkinder, die eine Capri Sonne kaufen, Mütter, die ihren Kleinen ein Rosinenbrötchen in die Hand drücken. Und du bist am Verkehrsknotenpunkt. Direkt am Chlodwigplatz, hier muss jeder vorbei. Es ist ein schönes Gefühl die Menschen, die zur Arbeit müssen, von seinem Stehtischchen aus beobachten zu können und zu wissen: Ich muss nicht zur Arbeit. Ich kann hier stehen und euch zuschauen. Das ist das Merzenich-Gefühl.
Nachdem Variante 1 oder 2 hinter einem liegt, könnte man erstmal ein paar Schritte gehen. Vom Formula Uno aus zum Beispiel in Richtung ....
Wenn es dann langsam Zeit für s Frühstück wird, fallen mir wieder mindestens zwei Varianten ein. Die gibt es vielleicht morgen. Hoffentlich auch noch ein Frühlingstag.
Mittwoch, 17. März 2010
Du bist Frühling
Ich werde wach, weil ein frühes Vogeltier vor meinem Fenster seine Geräusche macht. Ich glaube, es hat einen Wecker verschluckt. Ich bin ihm nicht böse dafür. Denn das Aufwachen ist schön. Obwohl es 6 Uhr 20 ist. Es hat sich was verändert. Neben der Vogelstimme liegen noch andere Stimmen in der Luft. Ich höre die Strasse wieder. Die Geräusche sind anders. Ein Freund sagte einmal, im Winter klingt die Stadt anders als im Sommer. Im Winter ist alles klarer und metallischer, im Sommer werden die Geräusche weicher. Ich glaube, er hat Recht.
Ich höre wieder Stimmen. Die Stimmen der Frühaufsteher, die sich morgens vor dem Kiosk einen Guten Morgen wünschen. Bald wird es wohlmöglich wieder heißen: „Machst du mir nen Kaffee fertig?!“ morgens um halb sieben in Ehrenfeld...
Die Zeit verändert sich. Heute ist der erste Tag, an dem es sich nach Frühling anfühlt. Ich spüre, höre, sehe die neue Zeit. Dass es gerade heute ist, passt sehr gut. Gerade heute werde ich wach mit dem Gefühl, etwas verstanden zu haben. Es ist etwas Wunderschönes. Vielleicht etwas, was alle schon wissen, was in vielen Möchte-gern-Psycho-Ratgebern steht, was viele bereits so erlebt haben, ich erlebe es jetzt: Veränderungen sind möglich. Das Tolle: Ich bin dafür selbst verantwortlich. Ich brauche auf nichts zu warten, was von außen kommt. Ich kann alles, wenn ich es nur will. Ich kann mich verändern. So wie ich dachte zu sein, muss ich nicht bleiben. Ich kann noch viel mehr rausholen aus diesem Leben. Ich muss nicht Winter bleiben. Ich kann Frühling werden. Und wenn dann erst der Sommer kommt...
Ich höre wieder Stimmen. Die Stimmen der Frühaufsteher, die sich morgens vor dem Kiosk einen Guten Morgen wünschen. Bald wird es wohlmöglich wieder heißen: „Machst du mir nen Kaffee fertig?!“ morgens um halb sieben in Ehrenfeld...
Die Zeit verändert sich. Heute ist der erste Tag, an dem es sich nach Frühling anfühlt. Ich spüre, höre, sehe die neue Zeit. Dass es gerade heute ist, passt sehr gut. Gerade heute werde ich wach mit dem Gefühl, etwas verstanden zu haben. Es ist etwas Wunderschönes. Vielleicht etwas, was alle schon wissen, was in vielen Möchte-gern-Psycho-Ratgebern steht, was viele bereits so erlebt haben, ich erlebe es jetzt: Veränderungen sind möglich. Das Tolle: Ich bin dafür selbst verantwortlich. Ich brauche auf nichts zu warten, was von außen kommt. Ich kann alles, wenn ich es nur will. Ich kann mich verändern. So wie ich dachte zu sein, muss ich nicht bleiben. Ich kann noch viel mehr rausholen aus diesem Leben. Ich muss nicht Winter bleiben. Ich kann Frühling werden. Und wenn dann erst der Sommer kommt...
Dienstag, 9. März 2010
Hundekotgedanken
Der gestrige Dialog war ( Hallo Tim ☺ ):
Ich: „Ich könnte mal viel öfter in meinem Blog schreiben. Manche machen das täglich.“
Er: „ Ja, manche sind aber sowas von langweilig. Die schreiben auch über Hundekot.“
Hm, dachte ich mir, über Hundekot schreiben. Was würde da wohl bei mir rauskommen?
Darum beginne ich diesen schönen, sonnigen Morgen mit Gedanken über Hundekot.
Erstmal vorab: Ich mag Hunde. Halt! Ich mag Hunde, die mir über´s Knie reichen. Was kleiner ist, finde ich in aller Regel nicht Hund. Da passiert nichts bei mir. Kein „Och, ist der süß!“ oder „So einen will ich haben!“ Darum ist Kleinhundkot generell schon mal störender als Großhundkot. Grosse Hunde fressen, rennen, und sind sowieso viel netter, und dürfen mal einen Haufen auf meinen Bürgersteig setzen. Wenn Grosshundbesitzer, die ja sowieso schon viel sympathischer sind, diesen Haufen dann noch wegmachen, ist die Welt in Ordnung. Kleinhunde sind überflüssig, und darum ist auch ihr Kot überflüssig. Kleinhundbesitzer haben es schwerer bei mir. Wer einen kleinen Hund an der Leine führt, der wird von mir automatisch verdächtigt, diesen als modisches Accessoire zu benutzen. Halt, ich denke da nicht an die liebe Omi, die ihren 25 Jahre alten Dackel spazieren schleicht. Sondern an die hippe 28ige, die diesen kleinen, weiss-braun, mit schwarzem Augenfleck-Hund besitzt, der in jede Kneipe mitgenommen wird.
Jetzt werde ich fast zum möchte-gern-lustigen Kolummnen-Schreiber, der über die Welt lästert und dafür beklatscht werden möchte. Das liegt mir eigentlich nicht. Bei manchen Dingen fällt es allerdings schwer sich mal nicht hinreißen zu lassen. Außerdem ist es wohl nachvollziehbar, dass das Thema Hundekot nicht soviel hergibt, als dass es mich fesseln könnte, und ich Zeile um Zeile dazu schreiben will.
Dennoch will ich mal wieder zurück zum stinkenden Ursprung. Wenigstens für einen Schlußsatz. Sozusagen eine Moral von der Geschicht. Die Hundekot-Moral: Jeder Hund, ob gross ob klein, setzt mal einen Haufen rein. Tret ich hinein, machts mich nicht froh, doch denk, der muss halt auch mal auf s Klo.
Ok, ich habs versucht: einen Blog über Hundekot. Ich höre auf, bevor es noch peinlicher wird.
Immerhin schreibe ich jetzt in meine Labels: Hundekot. Das ist doch mal was.
Ich: „Ich könnte mal viel öfter in meinem Blog schreiben. Manche machen das täglich.“
Er: „ Ja, manche sind aber sowas von langweilig. Die schreiben auch über Hundekot.“
Hm, dachte ich mir, über Hundekot schreiben. Was würde da wohl bei mir rauskommen?
Darum beginne ich diesen schönen, sonnigen Morgen mit Gedanken über Hundekot.
Erstmal vorab: Ich mag Hunde. Halt! Ich mag Hunde, die mir über´s Knie reichen. Was kleiner ist, finde ich in aller Regel nicht Hund. Da passiert nichts bei mir. Kein „Och, ist der süß!“ oder „So einen will ich haben!“ Darum ist Kleinhundkot generell schon mal störender als Großhundkot. Grosse Hunde fressen, rennen, und sind sowieso viel netter, und dürfen mal einen Haufen auf meinen Bürgersteig setzen. Wenn Grosshundbesitzer, die ja sowieso schon viel sympathischer sind, diesen Haufen dann noch wegmachen, ist die Welt in Ordnung. Kleinhunde sind überflüssig, und darum ist auch ihr Kot überflüssig. Kleinhundbesitzer haben es schwerer bei mir. Wer einen kleinen Hund an der Leine führt, der wird von mir automatisch verdächtigt, diesen als modisches Accessoire zu benutzen. Halt, ich denke da nicht an die liebe Omi, die ihren 25 Jahre alten Dackel spazieren schleicht. Sondern an die hippe 28ige, die diesen kleinen, weiss-braun, mit schwarzem Augenfleck-Hund besitzt, der in jede Kneipe mitgenommen wird.
Jetzt werde ich fast zum möchte-gern-lustigen Kolummnen-Schreiber, der über die Welt lästert und dafür beklatscht werden möchte. Das liegt mir eigentlich nicht. Bei manchen Dingen fällt es allerdings schwer sich mal nicht hinreißen zu lassen. Außerdem ist es wohl nachvollziehbar, dass das Thema Hundekot nicht soviel hergibt, als dass es mich fesseln könnte, und ich Zeile um Zeile dazu schreiben will.
Dennoch will ich mal wieder zurück zum stinkenden Ursprung. Wenigstens für einen Schlußsatz. Sozusagen eine Moral von der Geschicht. Die Hundekot-Moral: Jeder Hund, ob gross ob klein, setzt mal einen Haufen rein. Tret ich hinein, machts mich nicht froh, doch denk, der muss halt auch mal auf s Klo.
Ok, ich habs versucht: einen Blog über Hundekot. Ich höre auf, bevor es noch peinlicher wird.
Immerhin schreibe ich jetzt in meine Labels: Hundekot. Das ist doch mal was.
Mittwoch, 3. März 2010
Neuland
Neuland
Veränderungen...
Ich bewege mich auf neuen Plätzen, ich werde neu bewegt. Es ist etwas, ganz viel, hinzugekommen. Ein neues Leben, was vorher ohne mich lebte. In einer anderen Stadt, mit anderen Menschen um sich. Anderen Frauen wurde aus diesem Leben erzählt. Nun erfahre ich davon. Nun teile ich es. Viele neue Namen sind in meinem Kopf. Wenn auch noch gesichtslos, „kenne“ ich plötzlich gleich zwanzig Menschen mehr. Freunde, Arbeitskollegen, Familie. Ich bekomme Geschichten, wie aus einem Buch vorgelesen, mache mir meine Bilder dazu.
Und ich? „Die Welt mit vier Augen sehen“, sagte ich. Wenn ich etwas sehe, dann denke ich ans sofortige Mitteilen. Und selbst wenn ich nicht mitteile, dann schaue ich für zwei. Denke, und erlebe es für zwei. So doppelt sich auch die Freude. Und irgendwie scheinen die Augen durch diesen mir neuen Menschen, einen Focus gewonnen zu haben. Sie schauen besonders gut hin, wenn es Schönes zu sehen gibt. Auch Trauriges nehmen sie auf. Alles, was rührt, zieht sie an. Ich fotografiere den Hund, der traurig vor dem Supermarkt sitzt, schreibe sms über zwei Schwäne auf dem See, schicke ein Lied, ein Brief erzählt von einem alten Paar in Cowboystiefeln, und von Ingrid, die meinen Namen in ihr Tagebuch schreiben will.
Ich rede und teile, rede vielleicht zu schnell. Alles, was schön war, lasse ich heraus. Aber ich beginne zu verstehen, dass nicht alles teilbar ist. Ich muss manches für mich behalten.
Der Mann, als mein Partner, ist Neuland für mich. Ich bin naiv. Tapse einfach hindurch, und denke sein Land lässt sich ebenso durchwandern wie meines. Ich erlebe, dass der nächste, ganz unbedacht gesetzte Schritt eine Fallgrube sein kann. Ich kann auf einen knackenden Ast treten, und wecke den Löwen auf.
Im Neuland zu sein, heißt Fremdes zu entdecken. Es gibt Landstriche, die gefallen mir nicht. Sie sind so anders als in meiner Welt. Ich möchte sie neugierig anschauen, sie erkennen und verstehen, und letztendlich respektieren.
Veränderungen...
Ich bewege mich auf neuen Plätzen, ich werde neu bewegt. Es ist etwas, ganz viel, hinzugekommen. Ein neues Leben, was vorher ohne mich lebte. In einer anderen Stadt, mit anderen Menschen um sich. Anderen Frauen wurde aus diesem Leben erzählt. Nun erfahre ich davon. Nun teile ich es. Viele neue Namen sind in meinem Kopf. Wenn auch noch gesichtslos, „kenne“ ich plötzlich gleich zwanzig Menschen mehr. Freunde, Arbeitskollegen, Familie. Ich bekomme Geschichten, wie aus einem Buch vorgelesen, mache mir meine Bilder dazu.
Und ich? „Die Welt mit vier Augen sehen“, sagte ich. Wenn ich etwas sehe, dann denke ich ans sofortige Mitteilen. Und selbst wenn ich nicht mitteile, dann schaue ich für zwei. Denke, und erlebe es für zwei. So doppelt sich auch die Freude. Und irgendwie scheinen die Augen durch diesen mir neuen Menschen, einen Focus gewonnen zu haben. Sie schauen besonders gut hin, wenn es Schönes zu sehen gibt. Auch Trauriges nehmen sie auf. Alles, was rührt, zieht sie an. Ich fotografiere den Hund, der traurig vor dem Supermarkt sitzt, schreibe sms über zwei Schwäne auf dem See, schicke ein Lied, ein Brief erzählt von einem alten Paar in Cowboystiefeln, und von Ingrid, die meinen Namen in ihr Tagebuch schreiben will.
Ich rede und teile, rede vielleicht zu schnell. Alles, was schön war, lasse ich heraus. Aber ich beginne zu verstehen, dass nicht alles teilbar ist. Ich muss manches für mich behalten.
Der Mann, als mein Partner, ist Neuland für mich. Ich bin naiv. Tapse einfach hindurch, und denke sein Land lässt sich ebenso durchwandern wie meines. Ich erlebe, dass der nächste, ganz unbedacht gesetzte Schritt eine Fallgrube sein kann. Ich kann auf einen knackenden Ast treten, und wecke den Löwen auf.
Im Neuland zu sein, heißt Fremdes zu entdecken. Es gibt Landstriche, die gefallen mir nicht. Sie sind so anders als in meiner Welt. Ich möchte sie neugierig anschauen, sie erkennen und verstehen, und letztendlich respektieren.
Sonntag, 28. Februar 2010
Zu kurz für eine Überschrift
Nur ein Gedankenge(t)witter:
Knabberte gerade ein Kürbiskernbrötchen. Das mache ich öfter (kleiner Tip: die von Bäckerei Merzenich sind die allerallerbesten!). Das mache ich manchmal mehrmals die Woche. Ich knusperte die knackigen Kerne, freute mich und dachte: Ich werde später mal keine Prostata-Beschwerden bekommen.
War Situationskomik! ..
Knabberte gerade ein Kürbiskernbrötchen. Das mache ich öfter (kleiner Tip: die von Bäckerei Merzenich sind die allerallerbesten!). Das mache ich manchmal mehrmals die Woche. Ich knusperte die knackigen Kerne, freute mich und dachte: Ich werde später mal keine Prostata-Beschwerden bekommen.
War Situationskomik! ..
Sonntag, 14. Februar 2010
Courage!
Die Woche Paris ist rum, und ich kann nur sagen: Ich habe heute morgen den Moment herbei gesehnt, in dem ich in dem roten Zug sitze.
Ich muss mal eine Warnung vorab senden: Das wird hier heute nicht lustig. Denn ich bin nicht lustig. Ich bin schwermütig. Die Kälte, das Grau, der Dreck, das Nicht-Hingehören nach Paris, lastet auf mir und wird sich in meinen Worten wieder finden. Darum schreibe ich. Denn ich weiss, dass ich Schwere beim Schreiben am besten loswerden kann. Schreiben ist schon ein merkwürdiges Ding. Da geht es einem gerade ziemlich schlecht, man schreibt irgendwas darüber, dass es einem gerade ziemlich schlecht geht, vielleicht noch mit übertriebenen Worten, zum Beispiel so: „Ich fühle mich alleine, als ich vor die Tür trete, aber eigentlich bin ich nicht alleine, denn da sind Tausende von kleinen, spitzen Mini-Schneeflocken, die sich alle an mich schmiegen wollen. Sie bleiben an mir kleben, kriechen in meinen Hals, geben mir dort feuchtkalte Küsschen, kitzeln mich in den Augen.“ Und da setzt das Phänomen ein: das Negative wird positiv, nur weil man darüber schreibt. Geschriebenes Unglück kann leicht gelebte Freude werden.
Und auch ich fühle mich schon wesentlich leichter nach diesen ersten Sätzen. Und das obwohl der Zug gerade mal das Pariser Banlieu hinter sich gelassen hat.
Ich weiss, dass ich hinter Lüttich ganz und gar frei bin von der Pariser Schwere. Ich gehöre nicht mehr nach Paris. Ich will nicht mehr durch die Strassen des 17. Arrondissement, gehen (den allerhässlichsten Teil zwischen Avenue de Clichy und der Peripherie, in dem meine Freunde, und wenn ich zu Besuch bin, auch ich, wohnen). Witzigerweise haben meine Freunde und ich den Höhepunkt gemeinsam erreicht (hui ;) ). Denn die beiden haben just in diesem Moment des Überdrusses ein neues Appartement gefunden. Ausserhalb von Paris. Ausserhalb des Lärms, des Drecks, des Rennens. Mit Bäumen in unmittelbarer Nähe. Vielen Bäumen sogar, denn sie ziehen nach Maisons Lafitte. Da gibt es ein Schloss und einen Wald und Menschen mit viel Geld, die ihren Müll nicht auf die Strasse schmeissen müssen, und den Hundekot mit grösserer Wahrscheinlichkeit vom sauberen Trottoir pflücken.
Wenn einen von dort aus die Lust überkommt, nach Paris zu fahren, kann man das durchaus, mit einem festen Willen, guter Laune, und nur dreissig Minuten Fahrzeit bewerkstelligen.
Alles wird also gut.
So, jetzt bin ich in entsprechender Laune, um eine Geschichte aus Paris zu erzählen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum Feind dieser Stadt geworden bin. Ich kann immer noch staunend hindurch laufen, und mich an schönen Häusern, hübschen Geschäften, köstlichen Bäckereien und vor allem an interessanten Menschen, erfreuen. So zum Beispiel neulich morgens im Bus. Es sind noch keine acht Uhr, alle sind müde, machen lange, schläfrige Gesichter und sind halt so, wie Menschen morgens um halb acht in öffentlichen Verkehrsmitteln eben sind.
Wir sind noch keine fünf Minuten gefahren, da bleibt der Bus hinter einem Lieferwagen, der auf der Busspur parkt, stehen. Er bleibt stehen. Steht. Und steht. Warum überholt der denn nicht? frage ich mich. Das machen die doch sonst immer. Oder hupt. Mir fällt ein, dass ich beim Einsteigen eine Frau Busfahrerin begrüßt habe (ja, hier grüßt man den/die BusfahrerIn, und er, oder sie, grüßt zurück). Allez, Frau Busfahrerin, hup mal, fahr vorbei, mach irgendwas! Mach IRGENDWAS! Wird immer dringender, schliesslich will ich meinen Anschlusszug bekommen. Auch die anderen Fahrgäste werden immer unruhiger. Es wird schon leicht gemurmelt. Eine Frau steht auf und geht nach vorne. Vermutlich sagt sie ihr: Fahr doch dran vorbei, oder hup mal, aber mach irgendwas. Allez! Scheinbar hat die Fahrerin ihre Gründe, das nicht zu tun. Die Frau scheint sie daraufhin zu bitten, sie aussteigen zu lassen, denn sie rupft wie wild an der Tür, die natürlich nicht aufgeht. (Es ist nicht gestattet, Fahrgäste ausserhalb markierter Bushaltestellen die Türen zu öffnen“. So ähnlich steht es vermutlich in der Dienstvorschrift) Sie wird laut. Ist zornig: „Laissez-moi sortir!!“ und nun passiert das, was ich für ein Wunder halte: Andere Fahrgäste mischen sich ein. „Laissez-lui sortir!“ rufen sie nach vorne. Wow, ich bin beeindruckt. Die müden Gesichter können sprechen. Sie setzen sich ein für diese Frau. Und wohl auch für ihr eigenes Weiterkommen. Plötzlich redet der ganze Bus. Die einen lauter mit der Frau, die jetzt hin und hergeht und immer wieder sagt. „Mais elle transporte des animaux ou quoi? Elle pense que`elle transporte des animaux.“ Nein, dass wir keine Tiere sind, die sie transportiert, wird klar, denn Tiere sprechen nicht. „Elle dort ou quoi?! fragt einer. „Elle lis son journal,“ empört sich die Frau, mit der alles anfing. ENDLICH fährt der Lieferwagen weiter und die Busfahrerin nimmt die Fahrt wieder auf. Aber ruhig wird es nicht im Bus. Alle schimpfen weiter. Ich rede mit meiner Nachbarin, andere reden wilder durcheinander. Scheinbar gefällt das der Busfahrerin nicht, denn an der nächsten Haltestelle sagt sie durch den Lautsprecher: „Terminus“. Das heisst Endstation. Hui, die Busfahrerin, die ich erst für eine unsichere, dienstbeflissene Anfängerin gehalten habe, hat Temperament. Und Mut. Wer bisher noch nicht gesprochen hat, der spricht jetzt. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen raus. Während wir auf den nächsten Bus warten, reden wir weiter. Wir sind ja jetzt sozusagen eine Herde, Leidensgenossen, Komplizen. Der Bus kommt, und darin vermischen sich nun die eingeweihten Fahrgäste mit den nicht eingeweihten. Ich muss an ein Youtube-Video denken. Das spielt in der New Yorker U-Bahn. Ein Mann kommt in den Zug, und fängt an zu lachen. Erst ganz langsam und dann immer doller. Die Fahrgäste, die zuerst etwas beschämt ins Schwarz schauten, fangen einer nach dem anderen, auch an zu lachen. Irgendwann lacht und brüllt der ganze Wagen. Dann hält der Zug an einer Haltestelle an. Die vergnügten Fahrgäste hören auf zu lachen, denn es kommen ja nun neue Fahrgäste in den Zug. Was sollten die denn denken?! Es wird ganz still, als die Neuen hineinkommen, aber dann platzt es heraus. Die eingeweihten Fahrgäste prusten los, lachen laut und nun mit einem echten Grund.
In den neuen Bus steigt eine Menge Menschen, die alle miteinander reden. „Warum reden die miteinander obwohl die nicht aussehen, als seien sie Freunde oder eine feste Gruppe?“ müssen sich die übrigen Fahrgäste fragen. Wir vermischen uns mit den anderen, und werden langsam stiller. Man erkennt sich noch, aber die Gesichter werden langsam wieder müder.
So, das sind die positiven Seiten von Paris: man erlebt Geschichten. In einer Stadt, die so voller Menschen ist, passiert andauernd etwas. Was ich mitnehme aus dieser Episode, ist die Courage, der Frau, die als erste aufgestanden ist. Ich möchte auch näher am Aufstehen sein, näher am Wort, um mich selbst und auch andere, zu verteidigen.
Voilà.
Ich muss mal eine Warnung vorab senden: Das wird hier heute nicht lustig. Denn ich bin nicht lustig. Ich bin schwermütig. Die Kälte, das Grau, der Dreck, das Nicht-Hingehören nach Paris, lastet auf mir und wird sich in meinen Worten wieder finden. Darum schreibe ich. Denn ich weiss, dass ich Schwere beim Schreiben am besten loswerden kann. Schreiben ist schon ein merkwürdiges Ding. Da geht es einem gerade ziemlich schlecht, man schreibt irgendwas darüber, dass es einem gerade ziemlich schlecht geht, vielleicht noch mit übertriebenen Worten, zum Beispiel so: „Ich fühle mich alleine, als ich vor die Tür trete, aber eigentlich bin ich nicht alleine, denn da sind Tausende von kleinen, spitzen Mini-Schneeflocken, die sich alle an mich schmiegen wollen. Sie bleiben an mir kleben, kriechen in meinen Hals, geben mir dort feuchtkalte Küsschen, kitzeln mich in den Augen.“ Und da setzt das Phänomen ein: das Negative wird positiv, nur weil man darüber schreibt. Geschriebenes Unglück kann leicht gelebte Freude werden.
Und auch ich fühle mich schon wesentlich leichter nach diesen ersten Sätzen. Und das obwohl der Zug gerade mal das Pariser Banlieu hinter sich gelassen hat.
Ich weiss, dass ich hinter Lüttich ganz und gar frei bin von der Pariser Schwere. Ich gehöre nicht mehr nach Paris. Ich will nicht mehr durch die Strassen des 17. Arrondissement, gehen (den allerhässlichsten Teil zwischen Avenue de Clichy und der Peripherie, in dem meine Freunde, und wenn ich zu Besuch bin, auch ich, wohnen). Witzigerweise haben meine Freunde und ich den Höhepunkt gemeinsam erreicht (hui ;) ). Denn die beiden haben just in diesem Moment des Überdrusses ein neues Appartement gefunden. Ausserhalb von Paris. Ausserhalb des Lärms, des Drecks, des Rennens. Mit Bäumen in unmittelbarer Nähe. Vielen Bäumen sogar, denn sie ziehen nach Maisons Lafitte. Da gibt es ein Schloss und einen Wald und Menschen mit viel Geld, die ihren Müll nicht auf die Strasse schmeissen müssen, und den Hundekot mit grösserer Wahrscheinlichkeit vom sauberen Trottoir pflücken.
Wenn einen von dort aus die Lust überkommt, nach Paris zu fahren, kann man das durchaus, mit einem festen Willen, guter Laune, und nur dreissig Minuten Fahrzeit bewerkstelligen.
Alles wird also gut.
So, jetzt bin ich in entsprechender Laune, um eine Geschichte aus Paris zu erzählen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum Feind dieser Stadt geworden bin. Ich kann immer noch staunend hindurch laufen, und mich an schönen Häusern, hübschen Geschäften, köstlichen Bäckereien und vor allem an interessanten Menschen, erfreuen. So zum Beispiel neulich morgens im Bus. Es sind noch keine acht Uhr, alle sind müde, machen lange, schläfrige Gesichter und sind halt so, wie Menschen morgens um halb acht in öffentlichen Verkehrsmitteln eben sind.
Wir sind noch keine fünf Minuten gefahren, da bleibt der Bus hinter einem Lieferwagen, der auf der Busspur parkt, stehen. Er bleibt stehen. Steht. Und steht. Warum überholt der denn nicht? frage ich mich. Das machen die doch sonst immer. Oder hupt. Mir fällt ein, dass ich beim Einsteigen eine Frau Busfahrerin begrüßt habe (ja, hier grüßt man den/die BusfahrerIn, und er, oder sie, grüßt zurück). Allez, Frau Busfahrerin, hup mal, fahr vorbei, mach irgendwas! Mach IRGENDWAS! Wird immer dringender, schliesslich will ich meinen Anschlusszug bekommen. Auch die anderen Fahrgäste werden immer unruhiger. Es wird schon leicht gemurmelt. Eine Frau steht auf und geht nach vorne. Vermutlich sagt sie ihr: Fahr doch dran vorbei, oder hup mal, aber mach irgendwas. Allez! Scheinbar hat die Fahrerin ihre Gründe, das nicht zu tun. Die Frau scheint sie daraufhin zu bitten, sie aussteigen zu lassen, denn sie rupft wie wild an der Tür, die natürlich nicht aufgeht. (Es ist nicht gestattet, Fahrgäste ausserhalb markierter Bushaltestellen die Türen zu öffnen“. So ähnlich steht es vermutlich in der Dienstvorschrift) Sie wird laut. Ist zornig: „Laissez-moi sortir!!“ und nun passiert das, was ich für ein Wunder halte: Andere Fahrgäste mischen sich ein. „Laissez-lui sortir!“ rufen sie nach vorne. Wow, ich bin beeindruckt. Die müden Gesichter können sprechen. Sie setzen sich ein für diese Frau. Und wohl auch für ihr eigenes Weiterkommen. Plötzlich redet der ganze Bus. Die einen lauter mit der Frau, die jetzt hin und hergeht und immer wieder sagt. „Mais elle transporte des animaux ou quoi? Elle pense que`elle transporte des animaux.“ Nein, dass wir keine Tiere sind, die sie transportiert, wird klar, denn Tiere sprechen nicht. „Elle dort ou quoi?! fragt einer. „Elle lis son journal,“ empört sich die Frau, mit der alles anfing. ENDLICH fährt der Lieferwagen weiter und die Busfahrerin nimmt die Fahrt wieder auf. Aber ruhig wird es nicht im Bus. Alle schimpfen weiter. Ich rede mit meiner Nachbarin, andere reden wilder durcheinander. Scheinbar gefällt das der Busfahrerin nicht, denn an der nächsten Haltestelle sagt sie durch den Lautsprecher: „Terminus“. Das heisst Endstation. Hui, die Busfahrerin, die ich erst für eine unsichere, dienstbeflissene Anfängerin gehalten habe, hat Temperament. Und Mut. Wer bisher noch nicht gesprochen hat, der spricht jetzt. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen raus. Während wir auf den nächsten Bus warten, reden wir weiter. Wir sind ja jetzt sozusagen eine Herde, Leidensgenossen, Komplizen. Der Bus kommt, und darin vermischen sich nun die eingeweihten Fahrgäste mit den nicht eingeweihten. Ich muss an ein Youtube-Video denken. Das spielt in der New Yorker U-Bahn. Ein Mann kommt in den Zug, und fängt an zu lachen. Erst ganz langsam und dann immer doller. Die Fahrgäste, die zuerst etwas beschämt ins Schwarz schauten, fangen einer nach dem anderen, auch an zu lachen. Irgendwann lacht und brüllt der ganze Wagen. Dann hält der Zug an einer Haltestelle an. Die vergnügten Fahrgäste hören auf zu lachen, denn es kommen ja nun neue Fahrgäste in den Zug. Was sollten die denn denken?! Es wird ganz still, als die Neuen hineinkommen, aber dann platzt es heraus. Die eingeweihten Fahrgäste prusten los, lachen laut und nun mit einem echten Grund.
In den neuen Bus steigt eine Menge Menschen, die alle miteinander reden. „Warum reden die miteinander obwohl die nicht aussehen, als seien sie Freunde oder eine feste Gruppe?“ müssen sich die übrigen Fahrgäste fragen. Wir vermischen uns mit den anderen, und werden langsam stiller. Man erkennt sich noch, aber die Gesichter werden langsam wieder müder.
So, das sind die positiven Seiten von Paris: man erlebt Geschichten. In einer Stadt, die so voller Menschen ist, passiert andauernd etwas. Was ich mitnehme aus dieser Episode, ist die Courage, der Frau, die als erste aufgestanden ist. Ich möchte auch näher am Aufstehen sein, näher am Wort, um mich selbst und auch andere, zu verteidigen.
Voilà.
Sonntag, 7. Februar 2010
Noch mehr Allalei
Ich denke nach, was ich da eigentlich eben berichtet habe. War da irgendetwas Berichtenswertes drin? Irgendein Informationswert? Nein. Ich hoffe wenigstens, es fanden sich Spuren von Unterhaltungswert. Und ich fürchte, es wird so weiter gehen. Denn es findet sich gerade kein roter Faden.
Wenn es also eh keine rotgefädelten Geschichten gibt, dann kann ich ja weitermachen mit meinen Überlegungen, an welche Orte ich gerne in Paris gehen möchte. Ich könnte mir vorstellen morgen früh auf den Markt in der Rue Mouffetard zu gehen. Unten am Ende der bevölkerten Marktstrasse ein bisschen Gesang, Akkordeon und Tanz bewundern und dann in das schöne Café, „Le Bourgogne“ gehen und einen Brief schreiben. Oh nein, mir fällt was Besseres ein: Auf dem Mouffetard-Markt war ich schon so oft. Ich glaube mir ist vielmehr mal nach dem Markt auf dem Boulevard, der zur Bastille hinführt. In der Gegend war ich lange nicht mehr.
Gibt es etwas, was ich essen möchte? Ausser natürlich Baguettes in jeglicher Form (aux céréales, aux figues, aux noix, bien cuit, une tradition, usw....). Ein Stück tarte. Ein crumble aux pommes, eine tarte normande. Ich sollte mich auch mal ausprobieren in dem grenzenlosen Joghurt-Angebot. Ich kann kälteperiodenlang vor dem Kühlregal stehen. So lange kann es dauern, bis man sich einen Überblick über die verschiedenen Varianten gemacht hat. Joghurt pur, achtmal verschieden, je nach gewünschtem Fettgehalt. Gerührt, fest oder als Mousse aufgeschäumt. Joghurt mit Früchten. Da vervielfacht sich das Angebot, denn es gibt ja so viele Früchte. Vervielfachen tut sich das ganze dann noch mal durch die verschiedenen Fettstufen. Auch beim Design des Bechers kann ich mir unter vielen einen Liebling auswählen. Klassisch im Plastikbecher hoch, im Plastikbecher flacher, mit mehr oder weniger drin. Im durchsichtigen Plastikbecher oder gar im Glas. Im Gross- oder Kleinfamilienpack oder, fast schon selten in Frankreich, einzeln. Dann die Joghurts, die man schon fast kaum noch Joghurt nennen möchte, wenn sie nach Apfelkuchen, Zitronentarte oder Weisser Schokolade schmecken. Die klassischen Desserttöpfchen gibt es auch, und machen mir die Wahl immer besonders schwer. Da gibt es zum Beispiel café liègeois, Mousse au chocolat, crème caramel, crème brulée. (O je, ich bekomme gerade ganz grosse Lust auf was Süßes!). Meistens kaufe ich mir nichts von alledem. Mir reicht schon die Auswahl nach dem für mich idealen Fromage blanc. Danach bin ich schon so erschöpft, dass ich zu mehr Entscheidungen nicht mehr in der Lage bin. Fromage blanc ist übrigens so etwas wie Quark. Aber rutscht viel besser runter als unser trockener Magerquark.
Paris ist überhaupt für mich eine Qual der Entscheidungen. Welcher Joghurt? Welches Baguette? Welches Café? Welche Richtung? Rechts oder links? Metro oder Bus?
Schon oft machte mich das gar nicht froh, sondern überforderte mich total. Ich sollte in solchen Momenten einfach MACHEN. Zu einem Joghurt greifen, auch wenn ein anderer vielleicht noch besser schmecken könnte, in das Café gehen, vor dem ich seit zehn Minuten stehe und zögere, auch wenn der Café da überteuert ist, und ich nicht weiß, ob die Atmosphäre mir tatsächlich zusagt. Ich will jetzt mal zackiger werden. Das nehme ich mir fast jedes Mal vor, wenn Paris vor mir liegt. Immer wieder scheitere ich.
Aber diesmal bin ich nicht alleine unterwegs.... Das sollte mich stärken.
Es ist jetzt viertel vor sechs, kurz vor Brüssel und ich kann schon ziemlich viel von meinem Gesicht im Fenster sehen. Die letzte Zugstunde wird es also nichts mehr mit Rausgucken. Macht nichts. Zwischen Brüssel und Paris gibt es eh nichts zu sehen. Das ist der ideale Moment um ein wenig die Augen zu schließen. Die sind auch gerade müde. Müssen ja für zwei gucken...
Wenn es also eh keine rotgefädelten Geschichten gibt, dann kann ich ja weitermachen mit meinen Überlegungen, an welche Orte ich gerne in Paris gehen möchte. Ich könnte mir vorstellen morgen früh auf den Markt in der Rue Mouffetard zu gehen. Unten am Ende der bevölkerten Marktstrasse ein bisschen Gesang, Akkordeon und Tanz bewundern und dann in das schöne Café, „Le Bourgogne“ gehen und einen Brief schreiben. Oh nein, mir fällt was Besseres ein: Auf dem Mouffetard-Markt war ich schon so oft. Ich glaube mir ist vielmehr mal nach dem Markt auf dem Boulevard, der zur Bastille hinführt. In der Gegend war ich lange nicht mehr.
Gibt es etwas, was ich essen möchte? Ausser natürlich Baguettes in jeglicher Form (aux céréales, aux figues, aux noix, bien cuit, une tradition, usw....). Ein Stück tarte. Ein crumble aux pommes, eine tarte normande. Ich sollte mich auch mal ausprobieren in dem grenzenlosen Joghurt-Angebot. Ich kann kälteperiodenlang vor dem Kühlregal stehen. So lange kann es dauern, bis man sich einen Überblick über die verschiedenen Varianten gemacht hat. Joghurt pur, achtmal verschieden, je nach gewünschtem Fettgehalt. Gerührt, fest oder als Mousse aufgeschäumt. Joghurt mit Früchten. Da vervielfacht sich das Angebot, denn es gibt ja so viele Früchte. Vervielfachen tut sich das ganze dann noch mal durch die verschiedenen Fettstufen. Auch beim Design des Bechers kann ich mir unter vielen einen Liebling auswählen. Klassisch im Plastikbecher hoch, im Plastikbecher flacher, mit mehr oder weniger drin. Im durchsichtigen Plastikbecher oder gar im Glas. Im Gross- oder Kleinfamilienpack oder, fast schon selten in Frankreich, einzeln. Dann die Joghurts, die man schon fast kaum noch Joghurt nennen möchte, wenn sie nach Apfelkuchen, Zitronentarte oder Weisser Schokolade schmecken. Die klassischen Desserttöpfchen gibt es auch, und machen mir die Wahl immer besonders schwer. Da gibt es zum Beispiel café liègeois, Mousse au chocolat, crème caramel, crème brulée. (O je, ich bekomme gerade ganz grosse Lust auf was Süßes!). Meistens kaufe ich mir nichts von alledem. Mir reicht schon die Auswahl nach dem für mich idealen Fromage blanc. Danach bin ich schon so erschöpft, dass ich zu mehr Entscheidungen nicht mehr in der Lage bin. Fromage blanc ist übrigens so etwas wie Quark. Aber rutscht viel besser runter als unser trockener Magerquark.
Paris ist überhaupt für mich eine Qual der Entscheidungen. Welcher Joghurt? Welches Baguette? Welches Café? Welche Richtung? Rechts oder links? Metro oder Bus?
Schon oft machte mich das gar nicht froh, sondern überforderte mich total. Ich sollte in solchen Momenten einfach MACHEN. Zu einem Joghurt greifen, auch wenn ein anderer vielleicht noch besser schmecken könnte, in das Café gehen, vor dem ich seit zehn Minuten stehe und zögere, auch wenn der Café da überteuert ist, und ich nicht weiß, ob die Atmosphäre mir tatsächlich zusagt. Ich will jetzt mal zackiger werden. Das nehme ich mir fast jedes Mal vor, wenn Paris vor mir liegt. Immer wieder scheitere ich.
Aber diesmal bin ich nicht alleine unterwegs.... Das sollte mich stärken.
Es ist jetzt viertel vor sechs, kurz vor Brüssel und ich kann schon ziemlich viel von meinem Gesicht im Fenster sehen. Die letzte Zugstunde wird es also nichts mehr mit Rausgucken. Macht nichts. Zwischen Brüssel und Paris gibt es eh nichts zu sehen. Das ist der ideale Moment um ein wenig die Augen zu schließen. Die sind auch gerade müde. Müssen ja für zwei gucken...
Allalei von unterwegs
Wieder auf Reisen. Wieder im Thalys. Ich schreibe hier „wieder“, weil ich schon einmal aus diesem roten Zug in meinen gelben Blog geschrieben habe. Das war vor gut vier Monaten. Im September. Da fällt mir ein, dass da am Ende der Zugfahrt das Licht draußen fehlte und ich nicht mehr hinaus schauen konnte. Ich beschwerte mich, immer nur mich im Spiegel der Scheibe zu sehen, anstatt schöne Landschaften. Heute wird das auch wieder so sein. Vermutlich schon früher, denn es ist Februar. Die Tage sind noch kurz. Gegen halb sechs werden die Landschaften verschwinden, und mein Gesicht immer deutlicher werden.
Toll! finde ich gerade, dass ich beides gleichzeitig kann. Ich dachte mir, ich sollte eigentlich die Zeit nutzen, die mir bleibt, um hinaus zu schauen, anstatt in den Laptop. Ich schaute also hinaus, tippte aber weiter. Das funktioniert. So als hätte ich, die aus dem Fenster schaut, nichts mit der, die tippt, zu tun.
Letztes Mal auf dieser Fahrt nach Paris, hatte ich das Bedürfnis von meinen Mitreisenden zu erzählen. Das waren vier französisch sprechende Rentner, die durch ihre gebildeten Gespräche auffielen. Die sitzen heute nicht im Zug. Muss mir also andere Beobachtungsobjekte suchen. Es fällt aber niemand auf. Lauter asiatisch ausschauende Zugmitbewohner gibt es heute um mich herum. Aber die sind still und bieten keinen Grund etwas über sie zu erzählen.
Dann schreibe ich lieber über meine Gefühle. Die sind selten still.
Übrigens fährt der Thalys in diesem Jahr schneller. Er braucht nur noch gut drei Stunden bis wir in der anderen Welt, Paris, sind. Habe also eine halbe Stunde weniger, um mit meinen Worten mein Hirn zu erforschen. Ich stelle es mir gerade vor, wie einen Staubsauger, der in meinem Hirn rumwuselt und in alle Ecken hineinguckt, und überall etwas findet, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert.
Gefühle also. Wie fühlt es sich an nach Paris zu fahren? Unaufgeregt. Es ist eine Stadt, die mir vertraut ist. Ich freue mich dennoch auf sie, denn ich mag sie. Ich freue mich auf Orte. Nach welchen Orten ist mir diesmal? Gerade ist mir danach noch mal den Montmartre zu erklettern. Auf den Stufen vor der Kirche sitzen und auf die Stadt ohne Grenzen gucken. Mir ist auch nach der Ile St-Louis- ein bisschen Seine-Wandern. Notre-Dame meiden. Vielleicht mal wieder ins 13/14 Arrondissement, die Rue d Alesia entlang. Ich sollte mir die Rue de Rivoli verbieten. Dahin gehe ich immer. Allerdings möchte ich eine Ausstellung im Hotel de Ville anschauen. Die liegt gleich an der Rue de Rivoli. Wird also nichts aus dem Verbot. Es ist eine Photoausstellung. Hotel de Ville-Rathaus- verpflichtet: eine Paris-auf-die-Schulter-klopfende Photoausstellung.
Ich merke gerade, dass die Ankündigung, über meine Gefühle zu schreiben, nicht wirklich eingehalten wurde. Es war zu verlockend mir zu überlegen, wohin ich gehen, was ich machen wollte.
Konzentration auf die Gefühle: Ich fahre dieses Mal nicht alleine nach Paris. Ich nehme jemanden mit. Er weiss es nicht so richtig, denn er ist nur gefühlt bei mir. Real läuft er gerade durch den Wald und misst sich mit anderen Läufern. Aber wenn ich in die Landschaft schaue, schaue ich für zwei. Und wenn ich etwas erlebe, erlebe ich für zwei. Ich freue mich darauf, dieses Mal mit dem Bewusstsein durch die Stadt zu laufen, dass ich nicht alleine bin. Es gibt da jemanden, dem ich alles erzählen kann. Ich werde mich vielleicht in ein Café setzen und einen Brief schreiben. Und eigentlich schreibe ich die ganze Zeit Briefe. Die kann man nicht anfassen, die braucht kein Briefträger herumzutragen, die gibt es nur in meinem Kopf.
Übrigens wird das wohl nichts mit den „nur gut drei Stunden“ bis Paris. Der Zug steht schon seit zwanzig Minuten unmotiviert auf der Strecke, und die Lautsprecherstimme benutzt in vier Sprachen das Wort Signalstörung.
Übrigens habe ich nun doch etwas Interessantes über die Asiaten entdeckt: Die zeichnen. Sie zeichnen Jacken und Hosen und haben Stoffschnipsel vor sich liegen. Aha, die haben den gleichen Grund nach Paris zu fahren wie ich: Die wollen auf die Messe. Messe für Stoffe und Besatzartikel. Die gehen einkaufen. Ich helfe ihnen dabei. Wenn sie zu mir an den Stand kommen, zeige ihnen Bänder, mit denen sie ihre Jacken und Hosen schmücken können.
Sollte ich mal aufhören? Wird der Text zu lang? Ich selber habe ja auch schon gar keine Lust einen Text anzufangen, wenn ich sehe, er geht noch ewig weiter.
Aber ich bin noch ganz gut im Fluss. Aber ich baue eine kleine Stromschnelle rein. Die rüttelt auf und hält wach.
Toll! finde ich gerade, dass ich beides gleichzeitig kann. Ich dachte mir, ich sollte eigentlich die Zeit nutzen, die mir bleibt, um hinaus zu schauen, anstatt in den Laptop. Ich schaute also hinaus, tippte aber weiter. Das funktioniert. So als hätte ich, die aus dem Fenster schaut, nichts mit der, die tippt, zu tun.
Letztes Mal auf dieser Fahrt nach Paris, hatte ich das Bedürfnis von meinen Mitreisenden zu erzählen. Das waren vier französisch sprechende Rentner, die durch ihre gebildeten Gespräche auffielen. Die sitzen heute nicht im Zug. Muss mir also andere Beobachtungsobjekte suchen. Es fällt aber niemand auf. Lauter asiatisch ausschauende Zugmitbewohner gibt es heute um mich herum. Aber die sind still und bieten keinen Grund etwas über sie zu erzählen.
Dann schreibe ich lieber über meine Gefühle. Die sind selten still.
Übrigens fährt der Thalys in diesem Jahr schneller. Er braucht nur noch gut drei Stunden bis wir in der anderen Welt, Paris, sind. Habe also eine halbe Stunde weniger, um mit meinen Worten mein Hirn zu erforschen. Ich stelle es mir gerade vor, wie einen Staubsauger, der in meinem Hirn rumwuselt und in alle Ecken hineinguckt, und überall etwas findet, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert.
Gefühle also. Wie fühlt es sich an nach Paris zu fahren? Unaufgeregt. Es ist eine Stadt, die mir vertraut ist. Ich freue mich dennoch auf sie, denn ich mag sie. Ich freue mich auf Orte. Nach welchen Orten ist mir diesmal? Gerade ist mir danach noch mal den Montmartre zu erklettern. Auf den Stufen vor der Kirche sitzen und auf die Stadt ohne Grenzen gucken. Mir ist auch nach der Ile St-Louis- ein bisschen Seine-Wandern. Notre-Dame meiden. Vielleicht mal wieder ins 13/14 Arrondissement, die Rue d Alesia entlang. Ich sollte mir die Rue de Rivoli verbieten. Dahin gehe ich immer. Allerdings möchte ich eine Ausstellung im Hotel de Ville anschauen. Die liegt gleich an der Rue de Rivoli. Wird also nichts aus dem Verbot. Es ist eine Photoausstellung. Hotel de Ville-Rathaus- verpflichtet: eine Paris-auf-die-Schulter-klopfende Photoausstellung.
Ich merke gerade, dass die Ankündigung, über meine Gefühle zu schreiben, nicht wirklich eingehalten wurde. Es war zu verlockend mir zu überlegen, wohin ich gehen, was ich machen wollte.
Konzentration auf die Gefühle: Ich fahre dieses Mal nicht alleine nach Paris. Ich nehme jemanden mit. Er weiss es nicht so richtig, denn er ist nur gefühlt bei mir. Real läuft er gerade durch den Wald und misst sich mit anderen Läufern. Aber wenn ich in die Landschaft schaue, schaue ich für zwei. Und wenn ich etwas erlebe, erlebe ich für zwei. Ich freue mich darauf, dieses Mal mit dem Bewusstsein durch die Stadt zu laufen, dass ich nicht alleine bin. Es gibt da jemanden, dem ich alles erzählen kann. Ich werde mich vielleicht in ein Café setzen und einen Brief schreiben. Und eigentlich schreibe ich die ganze Zeit Briefe. Die kann man nicht anfassen, die braucht kein Briefträger herumzutragen, die gibt es nur in meinem Kopf.
Übrigens wird das wohl nichts mit den „nur gut drei Stunden“ bis Paris. Der Zug steht schon seit zwanzig Minuten unmotiviert auf der Strecke, und die Lautsprecherstimme benutzt in vier Sprachen das Wort Signalstörung.
Übrigens habe ich nun doch etwas Interessantes über die Asiaten entdeckt: Die zeichnen. Sie zeichnen Jacken und Hosen und haben Stoffschnipsel vor sich liegen. Aha, die haben den gleichen Grund nach Paris zu fahren wie ich: Die wollen auf die Messe. Messe für Stoffe und Besatzartikel. Die gehen einkaufen. Ich helfe ihnen dabei. Wenn sie zu mir an den Stand kommen, zeige ihnen Bänder, mit denen sie ihre Jacken und Hosen schmücken können.
Sollte ich mal aufhören? Wird der Text zu lang? Ich selber habe ja auch schon gar keine Lust einen Text anzufangen, wenn ich sehe, er geht noch ewig weiter.
Aber ich bin noch ganz gut im Fluss. Aber ich baue eine kleine Stromschnelle rein. Die rüttelt auf und hält wach.
Montag, 25. Januar 2010
"Die Deutsche Bahn"
Immer beschweren sich alle über die Bahn. Über „Die Deutsche Bahn“. Beim Beschweren nennen sie gerne den vollen Namen. Ich beschwere mich nicht. Ich bedaure hin und wieder, dass ich zehn Minuten länger in der Kälte stehen muss, freue mich auch nicht, dass ich gleich meinen netten ICE verlassen muss, weil ich ausserplanmässig umsteigen muss, finde auch, dass Zug fahren in Deutschland sehr teuer ist, aber beschweren tue ich mich nicht. Bei wem auch? Wer ist denn Schuld? Wenn ein Zug Verspätung hat, dann kann doch nicht ein Mensch was dafür. Wenn er dann mehrmals Verspätung hat, hat scheinbar gleich ein ganzes Ding Schuld: Die Deutsche Bahn. Wer ist denn die Deutsche Bahn? Mit Sicherheit ist es nicht der Schaffner. Der sitzt doch im selben Boot wie wir. Schlimmer noch. Der hat nicht nur Verspätung wie wir, und somit einen längeren Arbeitstag, der muss dafür auch noch beschimpft werden. Und er muss am Verspätungstag zehnmal soviel erklären wie sonst. Ich könnte die Kette jetzt mal durchgehen, die Hierarchie-Leiter weiter hochklettern, um irgendwann beim Schuldigen anzukommen. Ich glaube, ich würde immer noch keinen finden.
In einem Unternehmen läuft doch auch nicht immer alles rund. Pannen gehören dazu. Das Schicksal haut uns doch immer mal wieder. Da geht was kaputt, da fehlt was, da hört man was nicht, da fehlt mir die Kraft, da verliere ich den Schlüssel, da habe ich mich verguckt, alles Dinge die passieren. Mal mehr mal weniger schuldig. Und selbst wenn Schuld, dann gibt es viel Schuld, die keine böse Schuld ist. Eine schicksalhafte Schuld.
Ich wollte aber eigentlich nur erzählen, wie gut es mir gerade geht. Hier in diesem Wagen der „Deutschen Bahn“. Draußen scheint die Sonne, mir freundlich ins Gesicht, draußen sind es böse Minusgrade, drinnen ist es freundlich warm. Eigentlich sollte ich im Wagen 31 sitzen. Aber der hat heute kältefrei. Wenn „mein“ Wagen, inklusive Sitzplatz fehlt, dann darf ich vielleicht in die erste Klasse? Ich darf. Ich ziehe meine Schuhe aus, schaue aus dem Fenster, genieße mein Butterbrot, alles ist ruhig und gut gelaunt und ich fühle mich wie in der Deutsche-Bahn-Werbung. Vielleicht sehe ich genauso schön aus, wie die Mutter, die mit ihrem attraktiven Mann und ihrem wohlerzogenen Kind am Deutsche-Bahn-Tisch sitzt und Memory spielt?
Neben mir wird telefoniert. Find ich gut. Was ich da so alles erfahre!
Oh, jetzt hat sie aufgehört. Da höre ich lieber mal auf mit diesem Blog. Sonst guckt sie nachher noch ab, liest meine Worte und fängt noch an, die Deutsche Bahn auch zu mögen. Dann wäre ich nicht mehr die absolute Minderheit.
Jetzt bietet sie mir ein Gummibärchen an. Ich muss Schluss machen.
In einem Unternehmen läuft doch auch nicht immer alles rund. Pannen gehören dazu. Das Schicksal haut uns doch immer mal wieder. Da geht was kaputt, da fehlt was, da hört man was nicht, da fehlt mir die Kraft, da verliere ich den Schlüssel, da habe ich mich verguckt, alles Dinge die passieren. Mal mehr mal weniger schuldig. Und selbst wenn Schuld, dann gibt es viel Schuld, die keine böse Schuld ist. Eine schicksalhafte Schuld.
Ich wollte aber eigentlich nur erzählen, wie gut es mir gerade geht. Hier in diesem Wagen der „Deutschen Bahn“. Draußen scheint die Sonne, mir freundlich ins Gesicht, draußen sind es böse Minusgrade, drinnen ist es freundlich warm. Eigentlich sollte ich im Wagen 31 sitzen. Aber der hat heute kältefrei. Wenn „mein“ Wagen, inklusive Sitzplatz fehlt, dann darf ich vielleicht in die erste Klasse? Ich darf. Ich ziehe meine Schuhe aus, schaue aus dem Fenster, genieße mein Butterbrot, alles ist ruhig und gut gelaunt und ich fühle mich wie in der Deutsche-Bahn-Werbung. Vielleicht sehe ich genauso schön aus, wie die Mutter, die mit ihrem attraktiven Mann und ihrem wohlerzogenen Kind am Deutsche-Bahn-Tisch sitzt und Memory spielt?
Neben mir wird telefoniert. Find ich gut. Was ich da so alles erfahre!
Oh, jetzt hat sie aufgehört. Da höre ich lieber mal auf mit diesem Blog. Sonst guckt sie nachher noch ab, liest meine Worte und fängt noch an, die Deutsche Bahn auch zu mögen. Dann wäre ich nicht mehr die absolute Minderheit.
Jetzt bietet sie mir ein Gummibärchen an. Ich muss Schluss machen.
Labels:
Bahnfahren,
Gummibärchen,
Zug
Abonnieren
Kommentare (Atom)